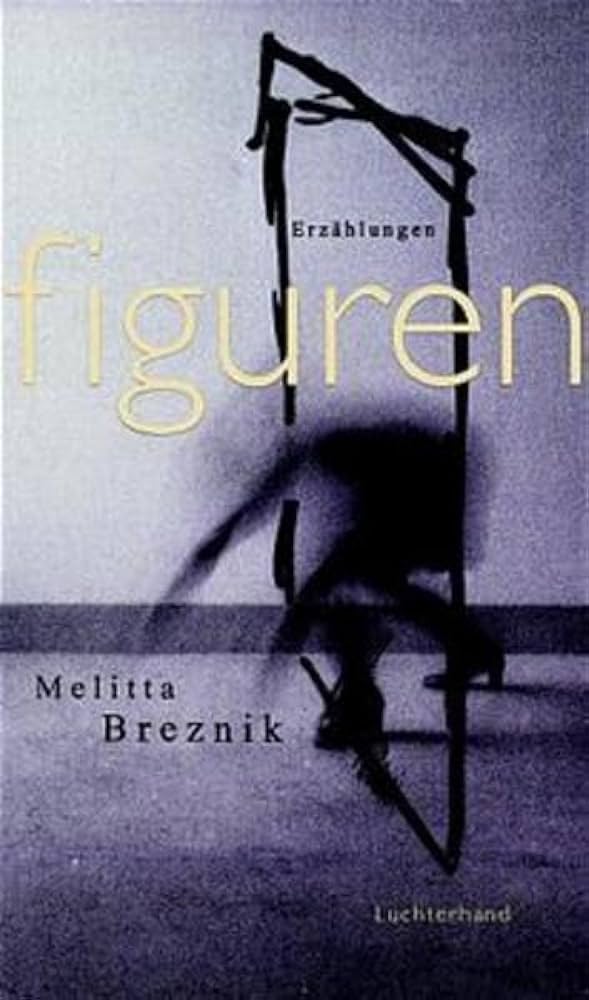Es sind wehmütige Geschichten, aber nie jammervolle. Bestimmend sind Erinnerungen an die Studentenzeit, geprägt durch die WG-Kultur mit ihren komplizierten Beziehungen, dem ewigen Politisieren und einem merkwürdig folgenlosen Revoluzzertum. Stets sind es Krisensituationen, die solche Erinnerungen auslösen. In der ersten Erzählung die Probleme eines ehemaligen Mitbewohners, Alkoholikers und Homosexuellen, der ewig im Kampf mit seinen Erwartungen liegt und sich ab und zu einem leidigen „Katzenjammer über die Männer […] oder besser deren Abwesenheit“ (S. 12) hingibt. Der Name einer Selbstmörderin erinnert in einer anderen Geschichte die Erzählerin an eine ehemalige beste Freundin, mit der sie sich damals gegen die Welt verschworen hatte: „Wir hatten keinen Zweifel, daß wir es besser machen würden als unsere Mütter, anders auf alle Fälle, und wir versicherten uns, aneinander festzuhalten, was in aller Welt sollte uns trennen.“ (S. 40) Das, was Freundschaften zusammengeschweißt hat, trennt diese zum Schluss: die gemeinsame Studienzeit. Danach geht’s ins Berufsleben, in tausend verschiedene Himmelsrichtungen.
Einige der Geschichten spielen im Spital (wie schon das literarische Debüt Brezniks), bedrücken durch leise und eindringliche Szenen, in denen man die angsterfüllte Luft der Krankenzimmer und Gänge beinahe riechen kann. Meist können die Angehörigen nicht mit den tödlichen Krankheiten umgehen, schlechter zumindest als die Erkrankten selbst. Hannes etwa „machte kein Hehl aus seiner Krankheit, nannte sie bei ihrem richtigen Namen“ (S. 61). Und dass die Erzählerin, eine gute Freundin, bei seinem Tod nicht nur Trauer, sondern auch Angst vor AIDS bekommt, gehört dazu: „Das Begräbnis ist morgen, ich werde nicht dabei sein können, aber ich weiß, daß ich im Herbst endlich den Bluttest machen muß, den ich schon seit letztem Winter vor mir hergeschoben habe.“ (S. 61) Diese Selbstbezogenheit ist eines jener vielen Phänomene, die Melitta Breznik nur andeutet, ohne sie endgültig festmachen zu wollen. Man kann diese Erzählungen mit Skizzen vergleichen: im Detail bewusst unausgearbeitet; feine Linien, prägnant, jedoch ohne grobe Kontraste.
Den Figuren widerfährt Ungewöhnliches, manchmal Schockierendes oder einfach nur ein Zufall, den man auch als Schicksalsschlag bezeichnen könnte. Manchmal scheinen sie auch in einer Szene vollkommen fehl am Platz zu sein. Zum Beispiel Elsa. Nach zwei Selbstmordversuchen lebt sie zurückgezogen auf dem Land, hat mittlerweile geheiratet und zwei Kinder bekommen. Beim Rendezvous mit einer Ex-Mitbewohnerin sitzt sie gedankenverloren beim Kaffee und spielt mit ihren Kindern, als wären sie Requisiten, die sie sich zwar ausgesucht, mit denen sie aber doch nichts anzufangen weiß. Letztendlich nützt alles nichts, denn der nächste Rückfall in die Depression kommt bestimmt.
So wie sie beginnen, so enden die Geschichten Melitta Brezniks. Unspektakulär, ohne Schlußakkord, sondern eher mit dem, was man in der Musik als „fade out“ bezeichnet. Auch wenn man die einzelnen Figuren im nachhinein nicht immer unterscheiden kann: Übrig bleibt eine Ahnung von dem, was ihr Leben ausmacht.