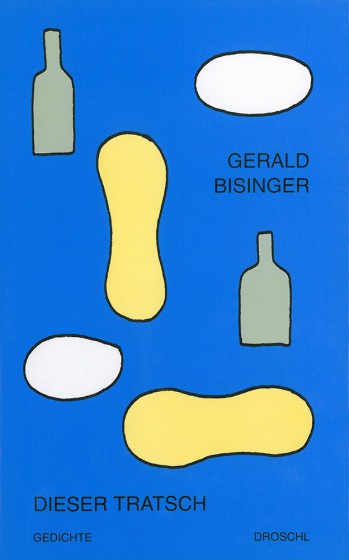Dieser Tratsch zitiert „This gossip“ und damit ein Gedicht aus Allen Ginsbergs „Kaddish“. Was so unscheinbar daherkommt, hat also doch wieder eine letale Schlagseite.
Die Verszeilen sind kurzatmiger geworden, aber immer noch klingt dank bewußt gebundener Rede ein antikisierender Rhythmus in der gesprengten Form. In beinah jedem Gedicht wird das Ich genau situiert – es sagt von sich, wo (meist: in welchem Gasthaus) es sitzt und was es (meist: Rotwein) trinkt und raucht.
Bisinger ist ein Liebhaber bescheidener Genüsse. So manches Gedicht gaukelt dem Leser vor, es befände sich in statu nascendi, wobei sich naturgemäß stets als ironische Pointe herausstellt, daß es schon fertig ist. Eine paradoxe Materialisierung scheint sich da zu vollziehen, eine Verwandlung von Wein und Rauch in Lyrik. Der wundersame Vorgang kann auch durch Speisen ausgelöst werden – so besteht das „Gedicht L“ aus einem Teil 1, der die Erwartung eines Beuschels mit Semmelknödel resümiert, und aus einem Teil 2, der die Lage nach dem Verzehr des Beuschels zusammenfaßt und allgemein behauptet: „die Erwartung schon / und die Ein- / verleibung schmackhafter Speisen / danach bewirkt das Entstehen von / Literatur“.
Daß, wer schreiben will, zuerst etwas erleben muß, hat für Bisinger keine Gültigkeit, betreibt er doch die größtmögliche Gleichzeitigkeit von Leben und Schreiben. Er verlegt den Prozeß des Dichtens in die Gegenwart und führt ihn vor, indem er mit dieser Gegenwart ganz auszukommen vorgibt: eine Art lyrische Live-Übertragung also, die den Leser zum Zaungast der Produktion macht, ohne ihn dabei etwa mit Schreibüberlegungen zu behelligen.
Bisinger ist als Literat auch ein fahrender Gesell – sehr gern schreibt er in der Bahn, im Speisewagen, versteht sich, sehr gern „verreist“ er nach Mürzzuschlag oder noch lieber nach Preßburg. Er nennt das wirklich „Verreisen“, manchmal liebt er in aller Bescheidenheit die große Geste für kleine Taten. Der Leser nimmt teil an den kleinen Niederlagen und den kleinen Siegen des Unterwegsseins. Er schwitzt mit dem Dichter an der Spree, er stürzt mit ihm in den Schneematsch von Bratislava, er freut sich mit ihm über die unvermutete Entdeckung einer Jószef-Bisinger-Promenade im mitgebrachten Stadtplan von Györ, und er begleitet ihn, wenn er das dem unbekannten Vorfahren gewidmete Straßenschild noch einmal in natura besichtigt.
Der vollständige Verzicht auf Interpunktion, gepaart mit hurtig über das Versende springenden Wörtern, verleiht vielen Versen etwas unruhig Schweifendes, Vagabundierendes, das den Grenzüberschreitungen des reisenden Ichs zu entsprechen scheint. Eine sinnvolle Gliederung der Textmenge ergibt sich nicht optisch, sondern klanglich, Unklarheiten können jedoch selbst beim lauten Vorsprechen bestehen bleiben. Die metrische Gestalt der Gedichte enthält auch ein Moment der Monotonie, sie wirkt wie eine Art akustisches Perpetuum mobile, was sich wiederum mit der inhaltlichen Insistenz dieser Lyrik verträgt. „Wiederholungen täuschen / trotz Veränderung Beständigkeit vor“, heißt es in einem Gedicht. Der Bisinger-Leser erinnert sich an wiederholte Besuche derselben Städte, Lokalitäten, Lokale, er weiß zum Beispiel, daß sein Dichter den Sommer in Berlin zu verbringen pflegt, wo er lange Jahre gelebt hat, und wo er nun in kühlen Kneipen der Hitze schreibend zu entfliehen sucht.
Im Vergleich zum letzten Band scheint Bisinger in seinem allerletzten epischer und auch nachdenklicher geworden zu sein. Er gedenkt so manches toten Freundes, befaßt sich eingehender mit seinen körperlichen Beschwerden und denkt nach wie vor unwillig an den Tod, denn: „Je älter ich werde desto mehr ge- / wöhne ans Leben ich mich“. Zum Leben des Gerald Bisinger gehört eben auch das Schreiben als eine Art liebe Gewohnheit, und im dauernden Schwanken zwischen dem „noch“ und dem „wie lange noch?“ fürchtet er sich vor dem Nichtmehrschreibenkönnen nicht weniger als vor dem Nichtmehrsein.
Mit Friederike Mayröcker plädiere ich dafür, diese „scheinbar mühelos hingeworfenen Parlandoverse“ in ihrem Alltagsgewand, in ihrer betonten Beiläufigkeit nicht gering zu schätzen. In ihnen erschafft sich ein Ich eben dadurch, daß es im Akt des Wahrnehmens aufgeht. „Dieser Tratsch“ ist nebenbei auch ein Bundesbahnblues und ein lyrischer Gastronomieführer, dem allein schon die authentischen Wirtshausnamen – „Zur eisernen Zeit“, „Zum Wilden Mann“ oder „Sittls Weinhaus zum Goldenen Pelikan“ – poetischen Glanz verleihen. Gerald Bisinger war ein Dichter der Räume und der im Gastgarten gastlich gemachten Natur. Getreu seinem Motto „Der Weise weihet sich dem Alkohol“ hat er seinen Weg zwischen Seneca und Lukrez gesucht, zwischen Stoik und Epikureertum.