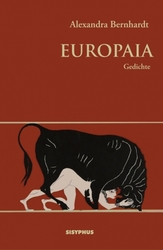Diesem ohnehin nur schwer fassbaren Topos rückt die Wahl-Wienerin Alexandra Bernhardt nun ausgerechnet mit den Mitteln der Lyrik zu Leibe, oder sollte man besser sagen: zu Geiste? 1974 in Bayern geboren, hat die Schriftstellerin Philosophie, Gräzistik, Komparatistik und Orientalistik in Deutschland und Österreich studiert, brächte also alle Voraussetzungen mit, sich der Materie auch von ganz anderen Seiten her zu nähern, analytischer, systematischer vielleicht, als dies in Gedichtform möglich erscheint.
Doch Alexandra Bernhardt legt hier ihren bereits dritten eigenen Lyrikband vor, gleichzeitig fungiert sie als Herausgeberin der Jahrbücher für Österreichische Lyrik 2019 und 2020/21. Damit hat sie den Überblick über die Bandbreite zeitgenössischen Gedichtschaffens, die Vielheiten möglichen poetischen Ausdrucks, mit denen einem so überbordenden Sujet vielleicht am angemessensten zu begegnen wäre.
„Europaia“, also „Europaartiges“, heißt ihr neues Werk. Dieser Titel impliziert zwar einerseits bereits eine vielgestaltige formale Herangehensweise an das heikle Unterfangen, bietet jedoch gleichzeitig einen ersten Hinweis auf den Anspruchsverzicht, ein voll umfängliches Bild des kulturellen Konstruktes Europa abgeben zu wollen. Die Betonung scheint vielmehr auf dem Fragmentarischen, dem Aufgefundenen, Zufälligen zu liegen.
In neun Kapitel hat Bernhardt ihren Gedichtband unterteilt, in welchen sie sich von jeweils anderer Warte ihrem Thema nähert. In den drei Texten der „Kleine[n] Alchymie“ mischen sich überreligiöse Aspekte von Weltentstehung („Destillation“) mit mythischem Raunen („Idiosynkratische Botanik“) und denkwürdigen Romantizismen („Seeligenweiß“) zu einer lyrischen Emulsion, deren Wirkung ambivalent ausfallen muss: einerseits verblüfft die Vielfalt des sprachlichen Ausdrucks, der vom Zitat hölderlinscher Emphase bis zur gebrochenen Fast-Verstummung der Nachkriegsmoderne reicht, andererseits scheinen die Texte überhaupt in keinerlei semantischer Beziehung zu stehen. Aber ist nicht genau das inhaltliche und formale Auseinanderdriften vielleicht eine der wichtigsten Eigenschaften dieses Europa, welches die Dichterin zu fassen sucht? Ihr geht es offenbar nicht besser als uns, auch und gerade wenn wir uns umschauen in unserem politischen Kontinent, der um Fassung und Inhalt ringt wie seit vielleicht siebzig Jahren nicht mehr.
Einen recht deutlichen Zugang legt uns die Dichterin im ersten Gedicht des zweiten Kapitels „Weltwinter“: „Ein Zeichen // Nicht der Vogelflug / aber eine Epoche // Nicht das Gekröse der Kapaune / aber eine Befindlichkeit // Nicht der Satz in der Alten Schalen / aber doch ein Blick // Darüber hinaus“. Das Zeichen scheint im Ganzen zu liegen, in der überzeitlichen Betrachtung kultureller Wirklichkeiten.
Und zeichenhaft-emulgierend geht es durchaus weiter, es reihen sich nahtlos attische Monatsnamen-Zitate an barocke Vanitasmotivik, aus der Antike abgeleitete Menschenbilder an Manierismen, die formal an Stefan George erinnern (Kleinschreibung und die berühmten Punkte in mittiger Höhe), während andere Texte wieder mit normaler Groß- und Kleinschreibung arbeiten. Die scheinbare Inkonsistenz setzt sich fort, doch wirkt sie nie als ein wildes Ausprobieren, sondern als bewusst eingesetzte Stolperschwelle für das Lesepublikum.
Im dritten Block, „Walden“, spielt Natur eine zentrale Rolle. Bernhardt spielt mit Neologismen und dem unkonventionellen Einsatz von Gleichheitszeichen, die sich freilich wahlweise wirklich als das Wort „gleich“ in den Textfluss einbauen lassen: “ […] fern gekernt beisamend da= / seinsreichen sammet= / segen tannderlich“. Die Wortspiele setzen sich auf unterschiedliche Weise in den folgenden Kapiteln fort, Zusammenziehungen etwa in den Begriffen „Europaranoia“ oder „Mementote“. Bedeutungen bleiben ambivalent und rhizomisieren durch den gesamten Textkörper. Nicht umsonst heißt eines der Kapitel denn auch „Rhizom: Scholia“. Ist es vielleicht das, was Europa im Innersten zusammenhält? Eine unsichtbare, pilzartige Verflechtung, die Kulturen und Sprachen, Volksgemeinschaften und Religionen, Zeiten und Regionen in eins schlingt, und welches uns die Dichterin in eben jenen „Scholia“, notizhaften Anmerkungen, nahe bringen möchte? „und es gebiert: / subterran verbundene seen. / vernetzte flüsse und ströme. / arme die sich verschränken. / schlangen die quellen aus / nöten blinde töchter / vormal’ger götter / nur nereiden“.
Im Kapitel „Babylonia“ mischen sich unterschiedliche fremdsprachliche Einsprengsel in den jeweiligen deutschen Trägertext der Gedichte und zeugen noch einmal von der wirkmächtigen Vielfalt der Europa beeinflussenden Traditionen. Auch onomatopoetische Verwechslungen wie etwa „der Hain“ und „la haine“ (frz. für: der Hass) sorgen wiederum für die bereits vorher festgestellten ambivalenten Lesarten der Gedichte. Bei alledem schwingt immer auch ein leicht ironisierendes Moment durch die bernhardtschen Zeilen, was die Kontingenz der Texte zusätzlich erhöht. Es gibt in diesen Versen kein So-sein-müssen. Das ist ihre Stärke, aber auch Grund für eine gewisse rezeptive Sperrigkeit ihrer Gedichte. Leicht zu lesen ist das alles eher nicht.
Einen weitgehend klarsprachlichen Abschluss liefert uns Bernhardt erst in ihrer „Reprise“, die äußerlich die Episode von Odysseus‘ siebenjährigem Aufenthalt auf der Insel der Nymphe Kalypso wiedergibt. In den anrührenden Versen von Gewöhnung und Abschied, Vergessen und teleologischem Getrieben-Sein kulminieren denn die eigentlichen lyrischen Qualitäten der Dichterin, die auf einmal ganz ohne die artifiziellen Volten der vorangegangenen Texte auskommt. Wenig überraschend: die eine Antwort auf die eingangs gestellte Frage, was genau Europa nun sei, hat auch Alexandra Bernhardt nicht. Aber ihre lyrischen Näherungen haben ihren eigenen Reiz.