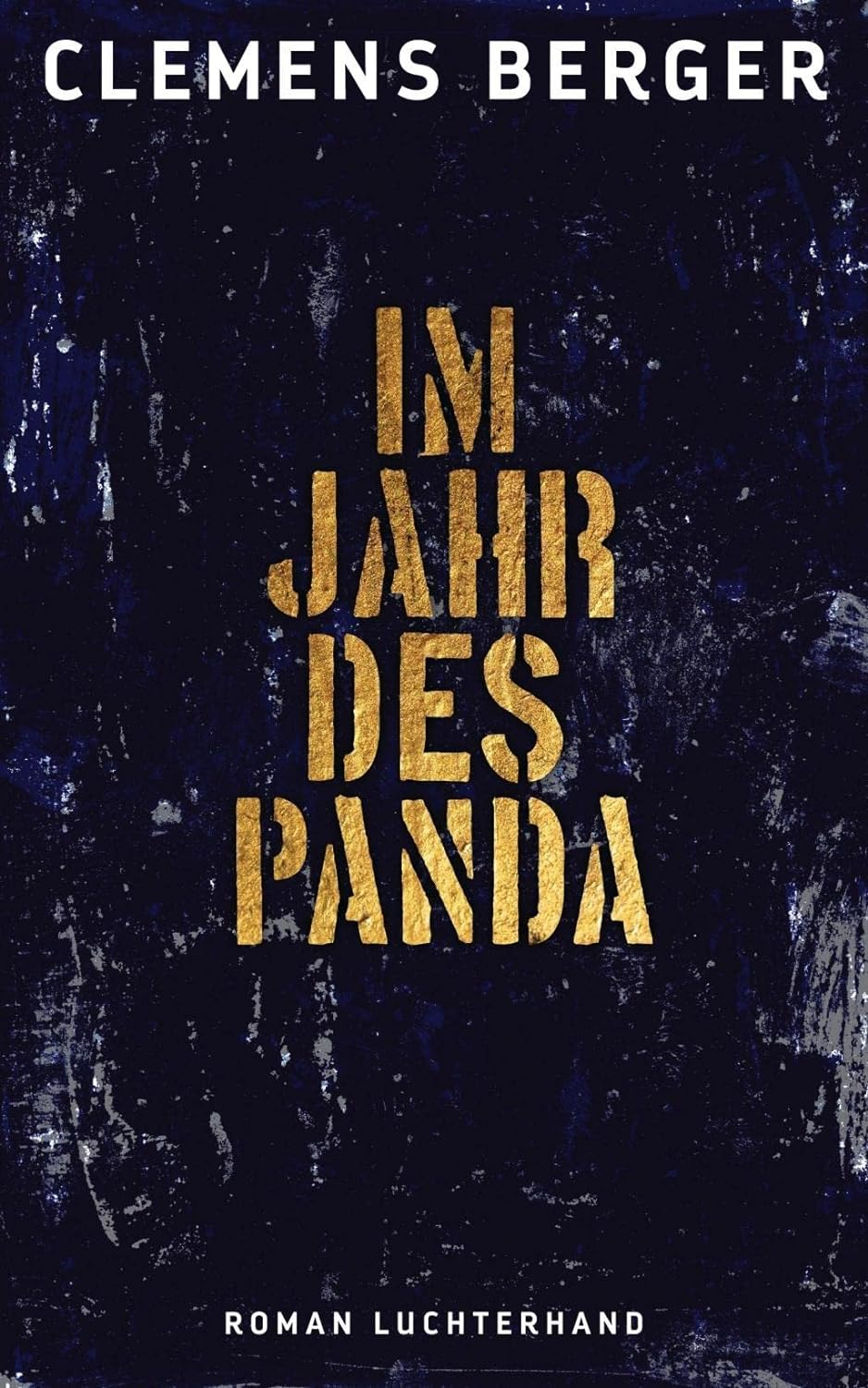Ab, der keinen Künstlernamen trägt, fühlt sich der Kunstwelt entfremdet – ihren pseudointellektuellen Codes, auf dekadente Weise kapitalismusfreundlichen Verhaltensweisen und Repräsentationsmechanismen, denen das kritische Moment von Kunst weniger Wert ist als der in Auktionshäusern hochgejubelte, zuweilen an Börsenkurse erinnernde. Kasimir Ab fühlt sich der im Social Web gefeierten und in Zeitungsmeldungen verurteilten Pia näher. Ihr Coup war mehr als nur die Aneignung fremden Eigentums. Er stand unter dem Vorzeichen einer sozialen Verteilungsideologie – Pia verteilte auf der Flucht Fünfhunderteuroscheine an Ärmere, kann aber im Kontext der staatlichen Befütterung gebeutelter Kreditinstitute in der Bankenkrise auch in einem realen Bezugsrahmen gesehen werden. Der Bankraub geriert sich nachträglich wie eine Aktion im öffentlichen Raum und an öffentlichem Gut. Als Pia ihr Tun anfangs mit frechen Gesten in Überwachungskamera und Internet kommentiert, macht sie sich bereits eine Fangemeinde. Angekommen in ihrer neuen Lebenswelt, postet sie auf Facebook immer wieder kritische Kommentare und sympathisiert mit Aktionen eines sogenannten „Unbekannten Künstlers“. Das stärkt ihre Idolwirkung. Pia zu liken wird hip, sich öffentlich für sie zu freuen Kult.
Vergleichbar ist diese Sympathie mit jener für das Kunstfälscher-Phänomen Wolfgang Beltracchi. Sein Betrug betraf die steinreichen Sammler und den völlig irrationalen Kunstmarkt. Skandalös ist die selbstverständliche und lässige Art, wie Beltracchi diese Welt entmystifiziert hat, indem er Gemälde als nicht-auratische Werkstücke behandelte, dabei sich selbst wie jedem der toten Künstler die Geniemaske (im Sinne einer Götzenkrone) abnahm und stattdessen überaus öffentlichwirksam die Technik des Fälschens offenlegte. Skandalös für die sich großbürgerlich abspaltende Kunstweltgesellschaft ist der Profit, den Beltracchi durch die Arbeit am Prozess der Entmystifizierung gemacht hat.
Kann Beltracchi sich freuen, weil er sich einen Namen gemacht hat, will Kasimir Ab das Gegenteil. Er kann aus den Codes seiner Galerien- und Vernissagengesellschaft unter seinem Namen nicht aussteigen ohne abzudanken. Das will er zunächst auch noch nicht, er ist Künstler – wenn auch einer, der sein Kindheitstrauma zum ständigen Motiv macht.
Ab entwickelt sich, inspiriert von Pia, zu jenem geheim agierenden „Unbekannten Künstler“, um sich mit systemkritischen kleinen Aktionen im urbanen Raum sozial zu solidarisieren. Sein Medium sind öffentliche Flächen und Objekte. Sie werden zum Dispositiv für virale Imitation und plakative Kunst: Wände, Bankomaten, multiplizierbare Sticker und als Krönung seiner Ironie mit „Limited Edition“ bestempelte Geldscheine. Der Fall Ab verhält sich zum Fall Beltracchi wie eine invertierte Parallele und offenbart einmal mehr die Abhängigkeit des Sammlerwerts vom Namen. Die Scheine würden ihren Nominalwert um das Vielfache übersteigen, wäre nur bekannt, von wem sie stammen. Beltracchis Fälschungen wurden nur als vermeintliche Werke toter Künstler hoch bewertet. Auf dem Kunstmarkt gibt es nur noch den Nominalwert und den an Authentizität geknüpften symbolischen Sammlerwert. Kritischer Wertgehalt und soziale Werte spielen keine Rolle. Berger führt in diesem Sinne vor Augen, wie jene Werte den Kunstmarkt heteronom bestimmen. Soziale und kritische Werte dagegen bleiben im autonomen Feld stecken. Dabei sind sie es, die den Bezug zur Gesellschaft wahren. Kasimir Ab leidet daran. Als Kasimir Ab ist er für „normale Menschen“ ein abgehobener Snob, als Unbekannter Künstler darf er sich der Beliebtheit und medialen Aufmerksamkeit erfreuen. Hier berühren seine Aktionen Menschen, hier kann er sie erreichen. Nach skurrilen Erfahrungen im Umgang mit seinen Gemälden unter der Hand des freien Marktes unternimmt er schließlich den ehrlichen Versuch aus der heteronomen Verstrickung auszubrechen.
Berger führt die Geschichten von Pia Swoboda und Kasimir Ab mit einer dritten um ein unfrei geborenes, aber gerade deswegen sich angstfrei bewegendes Pandajunges aus dem Tiergarten Schönbrunn zusammen. Der symbolische und nominale Wert dieses Geschöpfs mag als Kontrast und Vergleichsmaßstab zu jenem der Kunst gelten.
„Im Jahr des Panda“ ist ein packendes 670-Seiten-Werk. Schöne Cuts halten die Stränge der Geschichten über eine erzählte Zeitspanne von ein paar Jahren zusammen. Auffallend sind recht kleinteilige Handlungsbeschreibungen. Hin und wieder wird Belangloses ausgesprochen. Langweilig ist dies nicht, es fügt sich ein im inneren Film der Leserin. Wenn man erfährt, dass Julian Pia auf den Hintern klatscht oder die Geliebte Abs den Kopf im Nacken kreisen lässt, ehe sie den Zigarettenrauch in die Luft bläst oder die Finger entspannt sind, während die Zigarette zwischen ihnen steckt, liest sich das Buch wie mit heranzoomender Kamera, die gedanklich nichts auslassen will und die Vorstellungskraft der Rezipienten mitunter unterfordert. Stellenweise ist der Roman gar kitschig, vor allem in den Liebesszenen, und mit den Inhalten einhergehend wird der Erzählstil zuweilen gebrochen. Der Panda liest sein fiktives Tagesbuch, wohl verfasst von der Pflegerin; plötzlich wird von einer flirtigen E-Mail-Korrespondenz nicht erzählt, sondern diese abgedruckt. Die Charaktere sind klar beschrieben und in sich rund, Berger zeichnet sie psychologisch nicht derartig komplex, wie sie eigentlich sind. Wenn die Figuren aus der Erste-Person-Perspektive sprechen, wirken sie banaler als im narrativ erzeugten Bild. Etwas störend ist die subjektiv-suggestive Haltung des Erzählers an einigen Stellen, wenn dort etwa steht: „Jonathan reichte der schlechten Künstlerin die Hand“ und vorher bereits im Text stand, Ab fände die Kunst dieser Frau „verheerend“. Oder beim Diebstahl der Banknoten: „In fünfzehn Minuten würden sich die Diensthabenden in der Zentrale Pia und Julian aufzeichnen können – auf Papier, mit gut gespitzten Buntstiften Punkti, Punkti, Strichi, Strichi, fertig ist das Mondgesichti.“ Oder wenn der Erzähler durch eine Ellipse vielsagend wird: „In vielen Autos saßen zu dieser Zeit in dieser Stadt eine Frau und ein Mann. In einem saßen allerdings –.“ Oder wenn eine Kunstkritikerin bis zu dem Zeitpunkt, an dem mit Kasimir Ab intim wird, mit Vor- und Nachnamen genannt wird, dann nur noch mit Vornamen. Das sind kleine Schönheitsflecken, suggestiver Moralismus, der vermutlich keiner sein will.
Im Jahr des Panda ist ein fantasievoller Roman mit absurden Hyperbeln. Banalität und Erhabenheit treffen aufeinander, wenn Wissenschaftler bei beruflichem Anlass Pop-Karaoke singen oder ein Nachrichtensprecher bei laufender Sendung in eine Art Sommerloch abtritt. Das wirkt nicht überzogen, es wirkt vorstellbar in einer sich durch viel absurdere Mechanismen am Leben haltenden Welt. Kein Roman, den man nicht verfilmt sehen möchte, vielmehr die Art von Roman, die man als Primetime-Film nicht verpassen wollte. Spannend im Sinne von kurzweilig, ein großes, faszinierendes Gedankenexperiment.