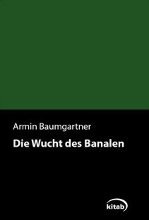Wobei dem Schildern, wo es sich anbietet, gerne auch hintergründig der Schalk zur Seite stehen darf. Baumgartner versteht es auf vorzügliche Weise, die Dinge in dichten poetischen Bildern und feinsinnigen prosaischen Kommentaren auf den Punkt zu bringen: „Plötzlich zerreißt ein tief fliegender Hubschrauber die Stille wie ein akustischer Zippverschluss“ (7). Der Punkt ist auch Teil der ästhetischen Programmatik, die dem Buch vorangestellt ist, nämlich als Punkt, „wo die Ahnung konkret wird, wo Gedanken Gestalt annehmen und greifbar werden. Hier hält er [der Schreiber, Anm.] inne und beginnt, Aufzeichnungen zu machen“ (5).
Und die Aufzeichnungen haben es in sich: Eigentlich sind es ja nicht in erster Linie Dinge, die in etlichen der 27 Kurzprosatexte des Bandes thematisiert werden, sondern Menschen und Tiere, die sich der Mensch allzu schnell und leichtfertig verdinglicht, wogegen Armin Baumgartner antritt, indem er das anthropogene Leid von Tieren schonungslos vor Augen führt, anhand scheinbar kleiner Begebenheiten, in denen sich aber das große Ganze widerspiegelt: Sei es im Tod einer Meise, die gegen die Balkontür knallt, was beim Begräbnis derselben Fragen hervorruft, was die Menschen in den Flugzeugen gefühlt hatten, bevor sie in das World Trade Center krachten („Der kleine Tod des Vogels“, 6 ff.), sei es am Beispiel der Rattenmutter in „Rattenfänger“ (121 ff.), der bei Filmaufnahmen „kurzerhand das Genick gebrochen“ (123) wird, damit sie endlich ruhig und still daliegt und die Jungen an ihr saugen können, um für die schnell zu beendenden Dreharbeiten das Bild der perfekten Tierwelt-Familienidylle abzugeben, was nach Armin Baumgartner ein weiteres schiefes Licht auf die Illusionsmaschinerie Film wirft: Nicht allein der Tod wird als Illusion inszeniert, auch das Leben.
Dem wird ein Dialog nicht zuletzt mit den Tieren entgegengesetzt, der sich an Jacques Derridas Begriff des „animot“ orientiert, der dem Tier das „-mal“ nimmt und durch „-mot“ ersetzt und damit den Menschen wieder näher an das Tier rückt, ihn am Tier verortet. Derrida prägte diesen Begriff in „Das Tier, das ich also bin“, das auch eines der Lieblingsbücher von Armin Baumgartner ist. Für Derrida war die Scham, die er nackt vor seiner Katze empfand, der Auslöser für seine Reflexionen und diese Scham, gerade wie die Menschen auch als geistige Nackerpatzeln den Tieren und sich selbst gegenübertreten, durchzieht als Grundstimmung viele der im Buch versammelten Geschichten, die natürlich auch ganz zentral und autobiografisch geprägt dem Menschen gewidmet sind: Menschen aus der näheren und weiteren Umgebung, also meist Wien und oft Ostmitteleuropa, das seit der „Zäsur“ („Svet je zázrak – die Welt ist ein Wunder“, 39) von 1989 intensiv bereist, studiert und in den Wahrnehmungshorizont einbezogen wird, besonders Polen.
Und es sind vor allem Menschen am sogenannten Rand der Gesellschaft, die ins Zentrum der Betrachtung gerückt werden, Kranke, an den Lebens- oder besser Überlebensbedingungen scheiternde Menschen, aus den Augen verlorene Freunde und Bekannte aus früherer Zeit, die wieder in Erinnerung gerufen werden, wie Thomas in „Das Recht auf ein gescheitertes Dasein“ (S. 81 ff.) und seine „Ablehnung der Teilnahme an einem soziale Gefüge mit all den damit verbundenen Attributen oder Vektoren wie Beruf, Karriere, Familie, Erfolg, Ferien, Glück, Kinder, Schule usw.“ und sein frühzeitiger Tod hinter der halb vollen Wodkaflasche über den Küchentisch gebeugt. Oder flüchtige Zugbekanntschaften, die nie mehr wieder gesehen wurden, wie der junge Pole Ireneusz Goebel in „‚Pulp Fiction‘“ – ein kurzer Schundroman“, (S. 15 ff.), der auf der Fahrt von Wien nach Warschau aus seinem Leben erzählt und von einer Szene aus „Pulp Fiction“, in der „auf Wallaces Genick ein Pflaster zu sehen“ (18) ist, was er mit einem antiken Totenritual vergleicht, „wo den Verstorbenen der Hals hinten aufgeschnitten wurde, damit die Seele entweichen kann“ (18). Kindheitserinnerungen aus den 1970er-Jahren, als Karel Gott neben Jesus Christus an der Wand hing (vgl. 13), finden sich in „Die langen grauen Haare“ (10 ff.). In Ausdrucksstärke und Dramatik etwa an David Lynch und Samuel Beckett erinnernd und dabei sprachlich virtuos komponiert ist die Begegnung mit einem zunächst wildfremden Menschen, der sich als „Rudolf“ zu erkennen gibt und vom Tod seiner Frau erzählt, allein auf dem Wienerberg in „Dienstag“ (34 ff., s. Leseprobe). Dingsymbole, wie ein verschobener Schamottestein in „Das Gesicht im Schamotteziegel“ (21 ff.) oder ein Fleischerhaken, der als Fragezeichen aufgefasst wird in „Lohn“ (9) wirken oft wie Metaphern, mal ganz konkret begriffen: als kunstvoll gestaltete Wort-Gefäße zur Darstellung, Veranschaulichung, Vermittlung und Fassung des kaum bis nicht Fassbaren.
Die hier genannten Prosa-Miniaturen weisen zusammen mit allen weiteren Die Wucht des Banalen als eine Art „Archiv der Ränder“ aus, in dem Armin Baumgartner den Grundfragen nach Begegnen und Verlassen, Finden und Verlieren, Erinnern und Vergessen, Sein und Nichtsein in einer höchst poetischen und bilderreichen Sprache nachgeht.