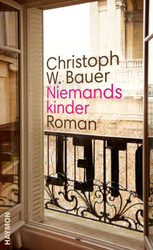Wie schon frühere Romane, etwa „Im Alphabet der Häuser. Roman einer Stadt“ (2007), ist auch Niemandskinder eng mit zeitgeschichtlichen Entwicklungen des Landes Tirol verwoben. Spannte Christoph W. Bauer in „Im Alphabet der Häuser“ einen extrem weiten historischen Bogen vom Mittelalter bis in die Mitte des 20. Jahrhunderts, hat der neue Roman eben das Ende dieses Bogens als Ausgangspunkt. Denn als ‚Niemandskinder‘ wurden die Kinder österreichischer Mütter und französisch-marokkanischer Besatzungssoldaten nach 1945 in Tirol bezeichnet. Der Ich-Erzähler, selbst Autor und Historiker, fühlt sich diesen Kindern sowohl aufgrund der eigenen Lebensgeschichte als auch wegen seines Berufs besonders verpflichtet. Als Kind war er mit einem ‚Niemandskind‘, Marianne, befreundet. Sie war Hasstiraden und Ausgrenzungen seitens der Tiroler Bevölkerung hilflos ausgesetzt. Als „Negerle, Bastard, Igelfresserin“ wurde sie beschimpft und als Fremde aus der sozialen Gemeinschaft ausgeschlossen. Marianne entfloh als Jugendliche diesem bedrückenden Umfeld, seitdem gilt sie als verschollen. Mariannes Geschichte ist jener der zweiten weiblichen Hauptfigur des Romans nicht unähnlich, Samira, der späteren Lebensgefährtin des Ich-Erzählers.
Samira ist eine junge Französin, ihre Großeltern stammen aus Marokko, die Eltern zogen nach La Courneuve, eine banlieue im Norden von Paris. Als junger Dichter lernt sie der Ich-Erzähler in einer Bar im Pariser Intellektuellen-Viertel Quartier Latin kennen. Bezeichnend ist die Antwort auf die Frage des Ich-Erzählers, ob Samira ihm nicht einmal ihre Heimatstadt zeigen wolle: „Auf eine derart bescheuerte Idee kannst auch nur du kommen!“ Samira versucht ihre Herkunft zu verleugnen, ebenso ergeht es dem Erzähler. Auch er möchte seine französische Freundin nicht seiner konservativen Tiroler Familie vorstellen. Die beiden erproben ein auf die Gegenwart ausgerichtetes gemeinsames Leben, fern individueller Vergangenheit. Doch obwohl die Liebesbeziehung überaus romantisch beginnt – Rilke-Gedichte werden im Jardin Luxembourg vor dem Karussell rezitiert – scheitert das Beziehungsexperiment aufgrund mangelnder gemeinsamer Zukunftsvisionen. Samira sehnt sich nach einem finanziell abgesicherten Familienleben, der Ich-Erzähler möchte seinen Traum vom Leben als Pariser Bohemien kompromisslos weiterverfolgen. Schlussendlich geht die Trennung von Samira Hand in Hand mit dem Ende seiner Dichterambitionen und dem Beginn eines Geschichtestudiums in Innsbruck. Niemandskinder fügt unterschiedliche Zeitebenen und diverse Schauplätze wie die noble Pariser Innenstadt und die Tiroler Provinz geschickt zu einem Mosaik an Geschichten und Figuren zusammen.
Behänd wechselt der Autor zwischen Etappen der Lebensgeschichte des etwa 50-Jährigen Protagonisten und Aspekten der Tiroler Zeigeschichte nach 1945. Der in Deutschland geborene Ich-Erzähler stammt aus einer Familie, in der Hass gegen die Franzosen tief verwurzelt war. Die Großmutter, die sich trotz persönlicher Verluste stets zur NS-Herrschaft bekannte, klagte über die schrecklichen Zustände unter der französischen Besatzung. In ihrer Erinnerung war die Besatzungszeit von Plünderungen, Vergewaltigungen und unsäglichem Leiden geprägt. „Und immer dieser Hunger! Großmutter schlägt die Hände u?ber dem Kopf zusammen. Ein Vierteljahr lang keine einzige Kartoffel, Endiviensalat ohne Essig, 1/8 Liter Magermilch pro Magen muss reichen fu?r eine Woche.“ Christoph W. Bauer thematisiert mit der unreflektierten Ablehnung der Alliierten, die das Ende des Nationalsozialismus ermöglichten, ein brisantes Thema. Als ein Motiv für diesen Hass erkennt der Ich-Erzähler den Wunsch nach Verdrängung: „Sie [die Großmutter] redete immer nur vom eigenen Leid, als ließe sich anderes dadurch, wenn schon nicht ungeschehen machen, so doch zumindest entschuldigen.“ In diesem Zusammenhang greift der Autor mit den ‚Niemandskindern‘ einen wenig beachteten Aspekt der österreichischen Zeitgeschichte auf. Da diese Kinder oftmals marokkanische Wurzeln hatten, ein Großteil der französischen Soldaten in Tirol und Vorarlberg waren Marokkaner, galten sie als besonders suspekt. Die Marokkaner wurden ebenso angefeindet wie die Frauen, die Beziehungen mit ihnen eingingen. Als „Negerflittchen und Franzosenhuren“ beschimpft, waren sie massiven Anfeindungen ausgesetzt, ihre Namen wurden mitunter an öffentlichen Plätzen angeschlagen. Selbst Gerüchte von Kindesabnahme durch die französischen Alliierten kursierten in dem von Ablehnung geprägten Westösterreich nach 1945.
Präzise beschreibt Bauer einerseits die Anfeindung der ‚Niemandskinder‘ und ihrer Mütter im Tirol der unmittelbaren Nachkriegszeit, andererseits die konsequente Benachteiligung von MigrantInnen und Menschen mit Migrationshintergrund in der französischen Metropole in der Gegenwart, wo es um Gleichheit schlecht bestellt ist. Im Zuge der Durchleuchtung der gegenwärtigen Pariser Gesellschaft berichtet der Protagonist selbst von Erfahrungen der Ausgrenzung, die er in der Pariser U-Bahn zu spüren meint. Denn je nach Linien-Abschnitt sind Menschen einer gewissen Herkunft in der Mehr- oder Minderheit: „In der Métro begafft wie einer aus der Anderswelt, die Métro hat keine erste Klasse, doch sie hebt auch keine Unterschiede auf, ich spüre, was es heißt, sich nicht wohlzufühlen in der eigenen Haut, an der Gare du Nord steigen viele aus, spätestens ab Réaumur-Sébastopol sind Bleichgesichter wie ich in der Überzahl, Étienne Marcel, Les Halles, Châtelet, Cité“ (Vgl. Leseprobe). Die Fähigkeit zur Empathie zeichnet den Protagonisten aus, die Beschäftigung mit zeitgeschichtlichen Entwicklungen und der enge Kontakt zu Personen anderer Herkunft schärfen seinen Blick.
Eine Protagonistin in Niemandskinder ist zweifelsohne die Stadt Paris. Der junge Dichter wandelt verträumt auf Schauplätzen der Pariser Bohème wie dem Quartier Latin oder dem Jardin du Luxembourg nebst der Sorbonne, lernt aber dank seiner Freundin Samira auch zu kleine Wohnungen und die Pariser Vororte kennen. Die Reaktionen der Pariser Bevölkerung auf die schwarz-blaue Regierung Österreichs und die EU-Sanktionen gegen Österreich im Jahr 2000 werden geschildert, ebenso wie die angespannte Lage nach den „Januaranschlägen“ auf Charlie Hebdo 2015. Beeindruckend vollführt Christoph W. Bauer trotz des ruhigen Erzähltons viele rasche Wechsel zwischen Figuren, Stimmungen, Räumen und zeitgeschichtlichen Verortungen.
Mit viel Empathie für seine Figuren erzählt Christoph W. Bauer von Diskriminierung und Ausgrenzung aufgrund von Herkunft in unterschiedlichen Generationen in Europa. Klug konzipiert und atmosphärisch geschrieben, ist Niemandskinder ein Beispiel dafür, welch probates Mittel gute Literatur gegen individuelles und gesellschaftliches Empathiedefizit sein kann.