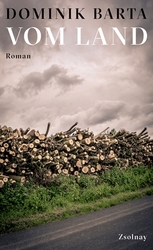Theresa ist sechzig, ihr Mann Erwin etwas älter. Ihr Hof liegt im fiktiven oberösterreichischen Pielitz, das Barta in der Nähe von Linz und Wels verortet. Die Kinder wollen den Betrieb nicht übernehmen. Tochter Rosalie, das jüngste Kind, arbeitet in einer Therme in einer größeren Nachbargemeinde von Pielitz. Sie ist mit dem Dachdecker und Weiberhelden Fridolin Kluger verheiratet. Ihr Sohn Daniel ist Theresas und Erwins einziger Enkel.
Der ältestes Sohn Max ist stellvertretender Geschäftsführer in einem Eferdinger Betrieb, der Stromspulen herstellt. Er hat nicht mehr viel mit seinen Eltern zu tun. Vor ein paar Jahren hat er geheiratet. Seine Eltern und seine Geschwister waren nicht zur Hochzeit eingeladen.
Das mittlere Kind hat keinen Namen und tritt in zwei der elf Kapitel als Ich-Erzähler auf. In zwei anderen ist er wahrscheinlich jener Zuhörer, den zum einen Theresas Schwester Josefa und zum anderen Max‘ Freund Sebastian Rainer mit Du anreden.
Liest man jene Kapitel, die der namenlose Sohn erzählt und in denen er (vermutlich) zum Zuhörer wird, fällt auf, dass die Sprache ähnlich jener der anderen Kapitel ist. Neben der Kürze der Sätze zeichnet diese Sprache zudem und damit zusammenhängend eine hohe Verdichtung aus. Ganze Biographien werden in einem Absatz zusammengefasst, Ereignisse der Handlung in wenigen Sätzen, aber dennoch anschaulich beschrieben. Auf die eingangs zitierten Sätze folgt beispielsweise der Versuch Theresas sich zu fangen: „Sie richtete sich auf und zog das Tuch vom Kopf. Die Stirn glänzte. Eine Strähne blieb an der Haut kleben. Sie hantelte sich am Holz entlang nach draußen, wo alles im Dunkeln lag.“ Dieses atemlose und kontrastreiche, schlaglichtartige Beschreiben charakterisiert den ganzen Text.
Erzählt der namenlose Sohn, der sich nur im dritten und im letzten Kapitel als Ich zu erkennen gibt, also auch die übrigen Kapitel? Im dritten Kapitel beansprucht er jedenfalls das Recht seine Geschichte selbst zu schreiben:
„Jeder hat das Recht, neu zu beginnen oder seinem Leben eine neue Form zu geben oder sich eine neue Ästhetik angedeihen zu lassen oder sich eine neue Geschichte zu erfinden. Man war seinen Umständen nicht bis ans Lebensende ausgeliefert.“
Dass er, wenn die Annahme stimmt, nun doch nicht seine eigene, sondern die Geschichte seiner Familie und die seines Geburtsortes erzählt, der für ihn mit dem Hass und der Ablehnung verbunden ist, die er als Heranwachsender dort erleiden musste, hängt mit seiner Mutter zusammen.
Theresas Kurzatmigkeit wird von ihr selbst für die Folge eines Magen-Darm-Virus gehalten. Weder ein Allgemeinmediziner noch ein Heiler können ihr helfen. Lethargisch liegt sie den ganzen Tag beim Kamin und spricht kein Wort. Nicht mit Erwin und auch nicht mit ihren Kindern, die sie besuchen.
Beim Abschied von Theresa erkennt das Ich: „Auch meine Mutter litt unter den Umständen. Auch sie hatte eine Seele, so wie ich und alle anderen Menschen. Sie sehnte sich nach diesem und jenem, und sie empfand, fühlte und verzweifelte bisweilen, wie wir alle. Doch weil mir mein eigenes Leid näher war, ließ ich sie liegen und fuhr davon.“ Aufgrund dieser Parallele erzählt der namenlose Sohn dann schließlich doch von seiner Mutter.
Weil sich niemand wirklich um sie und ihre Krankheit kümmert – Rosalie sieht sie als Kindermädchen für Daniel an, Max und das Ich besuchen sie selten, Erwin schätzt sie mehr als Hilfskraft bei der Hofarbeit denn als gleichberechtigte Partnerin -, besucht Theresa ihre Schwester Josefa, die am Attersee wohnt. Dieser Aus- und Aufbruch Theresas überrascht ihre Familie. Erwin will sie sofort wieder abholen. Theresa lehnt ab. Der Ich-Erzähler und Rosalie besuchen sie. Doch nur ihrer Tochter öffnet sie sich, wenn auch mit langem Anlauf und nicht vollständig.
Denn obwohl Rosalie erleichtert feststellt, „dass ihre Mutter das Wort an sie richtete“, also wieder mit ihr spricht, sprechen will, nutzt sie das erste gemeinsame Frühstück mit Theresa, ihrer Tante und ihrer Cousine dazu, sich über Fridolin auszulassen, der sie wieder mal betrogen hat: „Sie hatte das Bedürfnis, sich mitzuteilen.“ Im Gegensatz zu ihrer Mutter: Theresa bleibt bei diesem Gespräch still. „Mama, du sagst gar nichts?“, fragt Rosalie ohne eine Antwort zu bekommen.
Am Abend, als sie alleine sind, fragt Rosalie direkt, was ihr Mutter bedrückt und ob es etwas mit Erwin zu tun hat. Erst antwortet Theresa nur „unverständliche Dinge“, doch Rosalie fordert ihre Mutter auf zu sagen was los sei, da sonst „alles nur noch schlimmer“ werde. Theresa erklärt, dass für sie das Sprechen im Gegensatz zu Rosalie, ihrer Schwester und ihrer Nichte nicht so einfach sei: „Mir fällt es schwer mich auszudrücken. Sehr schwer!“ Und nachdem sie darüber nachgedacht hat: „Mit Erwin hat es nichts zu tun. Gleichzeitig hat alles mit ihm zu tun. Mein ganzes Leben. Er hat keine Schuld. Und doch trägt er an allem die größte Schuld! Ich kann es nicht ausdrücken. Das ist es, was mich krank macht.“ Bevor sie sich jedoch weiter, zu weit, öffnet, verlässt sie das Zimmer.
Theresa hat das Reden schon lange aufgegeben. Von seiner Tante Josefa erfährt der Ich-Erzähler zum Beispiel, dass sie selbst besorgt war, als Rosalie mit Daniel schwanger war, noch dazu von einem Mitglied der in Pielitz nicht gerade hoch angesehen Familie Kluger: „Wie in allen Dörfern, regierte in erster Linie die Angst vor den Nachbarn. Was würden die Nachbarn denken? Was würden sie sagen?“ Theresa störte das Gerede dagegen nicht, ihr ging es nur um die Gesundheit und das Glück ihrer Tochter. Das Gerede hört aber nie auf und dem Zuhören kann man sich nicht ewig verschließen.
Das weiß auch Daniel. Theresas Enkel freundet sich mit dem sechzehnjährigen Toti an. Dieser kommt aus Syrien und wohnt seit drei Jahren in Pielitz. Die Schule hat er abgeschlossen, darf aber keine Lehre machen. Aus Langeweile will er in Erwin Weichselbaums Wald ein Baumhaus bauen. Daniel entdeckt ihn und eine Freundschaft entsteht. Sie wird zum zweiten Schwerpunkt des Romans und auch hier nimmt das Schweigen eine zentrale Rolle ein. Denn Daniel weiß, dass er die Freundschaft zu Toti geheim halten muss. Unter anderem wegen seines Onkels Max, der Mitglied in der islamfeindlichen „Bewegung“ ist.
Toti versteht diese Bevorteilung der Freundschaft über die Familie nicht und klärt Daniel auf, dass für Araber „jeder Onkel, jede Tante, jeder Cousin, jede Cousine sehr wichtig [ist], auch wenn es manchmal schwierig ist, mit allen auszukommen!“ Daniel erwidert, dass es bei den Weichselbaums genau umgekehrt sei: „Aus der Familie kommen alle Probleme und nur aus der Familie.“
Totis und Theresas Probleme (und ihr Schweigen) werden im Lauf der Handlung aufeinandertreffen. In diesen späteren Kapiteln zeigt Barta drastisch, dass ein Problem zu einem solchen gemacht werden und von einem anderen ablenken kann. Wie Barta das zeigt, soll hier aber nicht verraten werden.
Die Ablenkung von einem Problem mit einem anderen wird aber schon im ersten Kapitel angedeutet. Theresa ist beim Arzt. Der fragt sie nach ihrem Appetit. Sie antwortet: „Mir ist schlecht. Das ist das Problem. Und ich bin schwach, wie selten.“ Das ist nicht ihr Problem. Zumindest nicht das wirkliche. Ein größeres Problem ist ihr Schweigen und ihr Verschweigen. Beides bricht Bartas Ich-Erzähler, der vielleicht auch der Erzähler des gesamten Romans ist. Atem- und schonungslos. Auch gegen sich selbst.