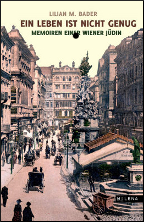Dass Baders Erinnerungen bereits vor der nun erfolgten Veröffentlichung in wissenschaftlichen Arbeiten oft zitiert wurden, liegt daran, dass Bader als eine der ersten Frauen an der Universität Wien einen Doktortitel in Chemie erhielt. Nun liegen Baders Erinnerungen, die sie bemerkenswerterweise in der erst spät erlernten Sprache Englisch verfasst hat, in der Übersetzung von Mascha Dabic auf Deutsch vor. Erschienen in der Verlagsreihe „Zeitgeschichte“ steht Baders Memoirenband inmitten von Aufzeichnungen anderer beispielhafter Lebensgeschichten des 20. Jahrhunderts. Neben der Neuausgabe von Hilde Spiels „Rückkehr nach Wien“ finden sich etwa die Aufzeichnungen Franziska Tausigs über ihre Emigration nach Shanghai oder die Beschreibung der Rückkehr nach Wien aus dem Konzentrationslager Ravensbrück von Mali Ernst und Hermine Jursa.
In ihren sehr persönlichen Erinnerungen lässt Bader das Wiener Fin de siècle durchaus lebendig wiederauferstehen. Geboren 1893 und aufgewachsen in einer, wie sie es nennt, amazonenhaften Umgebung, in der Großmutter, Mutter und Tante über das Leben und die Erziehung der zwei Schwestern Lilian und Hilda wachen, kommt der Vater nur am Rande vor. Dieser war aufgrund der schlechten Arbeitsmöglichkeiten in Wien gezwungen, eine Stelle in Teplitz anzunehmen und kam nur zu Besuchen in die Hauptstadt. Bader reflektiert die für damalige Verhältnisse ungewöhnliche Familiensituation folgendermaßen: „Es wäre interessant herauszufinden, welche Auswirkungen mein ungewöhnliches Familienleben auf mich hatte. Sind irgendwelche Komplexe aufgrund des Durcheinanders entstanden oder können irgendwelche Besonderheiten darauf zurückgeführt werden? Die vertauschten Rollen in der Familie bilden wohl seltsame Komponenten in der Entwicklung eines Individuums.“
Die behütete Kindheit und die Förderung der zwei Schwestern wird dort deutlich, wo Bader von den Lebensbedingungen der Hausmädchen und Köchinnen der Familie erzählt, die im Gegensatz zu den Schwestern keinerlei Möglichkeiten hatten, länger als bis zum Alter von 14 Jahren eine Schule zu besuchen. Bildung und Kultur spielen in der Familie eine herausragende Rolle. Die Musikalität der Schwester Hilda wird früh gefördert, später unterrichtet sie Klavier am Konservatorium und an der von der Familie geführten Schule. Bader berichtet von der berühmten großväterlichen Bibliothek, deren Märchen und Klassiker sie als Mädchen unter der Bettdecke lesend verschlingt.
Die vertauschten Rollen werden auch von Lilian Bader selbst gelebt. Nach dem Tod der Mutter führt sie das damals bekannte private Mädcheninternat, die Stern’sche Schule fort, während ihr Mann als Arzt praktiziert. Sie lebt zwei Leben parallel, führt den Haushalt der Familie und die Schule als Direktorin. Erst in der Emigration arbeitete sie in London – nach Anfangsjahren als Haushälterin bei einer englischen Familie – wieder in ihrem gelernten Beruf als Chemikerin.
Zahlreiche Anekdoten vermitteln ein lebhaftes Bild der sozialen und kulturellen Umgebung Wiens bis in die 1930er Jahre. Die gesellschaftlichen Veränderungen können am Beispiel der Entwicklung der Stern’schen Schule mitverfolgt werden. War die 1868 gegründete Schule ursprünglich und auch nach der Übernahme durch Baders Mutter und Tante 1903 eine der ersten Schulen, die Mädchen eine höhere Bildung vermittelte, so wurden die auf die Universität vorbereitenden Lyzeen bald darauf zur Konkurrenz. Der Ruf Wiens als Mittelpunkt des Vielvölkerstaats ließ Eltern ihre Töchter aus allen Teilen der Monarchie nach Wien schicken. Bader betont die Fortschrittlichkeit ihrer Mutter, die als Schulleiterin die ersten privaten Ferienlager in Salzburg und Kärnten initiierte und den Schülerinnen durch Oper-, Konzert- und Theaterbesuche einen Einblick in das reiche kulturelle Leben Wiens bot. Bader selbst führt die modernen Bestrebungen der Mutter fort und nimmt die Schülerinnen beispielsweise mit zu einer Vorlesung Emmeline Pankhursts, der berühmten englischen Suffragette.
Die politischen Ereignisse der Zeit sind immer eng mit dem privaten Erleben verbunden. Die Studentin Lilian Stern verliebt sich während des Krieges in einen jungen Arzt auf Heimaturlaub, nach dem Krieg übernimmt die verheiratete Lilian Bader 1919 die Schule der Mutter und kämpft in den wirtschaftlich schwierigen späten 1920er Jahren um deren Fortführung. Der Justizpalastbrand, das Attentat auf Dollfuss und der erstarkende Antisemitismus prägen das Erlebte und bestärken die klare Sicht auf die politischen Entwicklungen.
Obwohl die Niederschrift Baders nicht genau datiert werden kann, lassen einige Hinweise auf eine recht frühe Aufzeichnung des Erlebten gegen Ende der 1940er Jahre schließen. Die letzten Kapitel behandeln den Anschluss Österreichs im März 1938 und die in groben Zügen skizzierte baldige Flucht nach England und später nach Amerika. Von welchen Zufällen die geglückte Ausreise abhing und wie schwierig es war, sich im Durcheinander von Visabestimmungen und Ausreiseanträgen zurechtfinden, davon zeugen Baders Erinnerungen ausdrucksvoll und stellvertretend für die Erlebnisse zahlreicher Emigranten.
Als Leser verspürt man den Wunsch, dieser energiegeladenen und energischen Frau weiter folgen zu dürfen. Sicherlich wären auch ihre Erinnerungen an die Emigration und die neue Heimat Amerika es wert, als Zeitdokumente rezipiert zu werden. Was bleibt ist der Respekt für eine Frau, die durch ihre unmittelbare Art des Erzählens eine zeitgeschichtlich herausragende Epoche der österreichischen Geschichte am Beispiel einer persönlichen Familiengeschichte beeindruckend erlebbar macht.
In den Nachworten gelingt es ihrer Tochter Doris B. Whitman sowie den in den USA geborenen Enkelinnen eine weitere Facette zur Person Lilian Bader hinzuzufügen. Bezeichnend für Lilian Baders Ausstrahlungskraft sind sicherlich die Sätze ihrer Enkelin Lily Whiteman, die zwar den Namen ihrer Großmutter trägt, diese jedoch nie persönlich kennen gelernt hat: „Wenn ich heute bei meiner Mutter zu Besuch bin, kocht meine Mutter immer mein Lieblingsessen für mich: Gulasch und anschließend eine üppige österreichische Nachspeise, die aus mehreren Schichten besteht – es ist einfach ein Vergnügen, das mich immer an den intellektuellen und wohltuenden Einfluss erinnert, den meine Großmutter auf meine Kindheit ausübte. Er wirkt auch jetzt noch nach.“