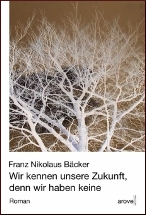Im Alltag hat sich wenig verändert in den letzten 31 Jahren. Nach wie vor vertreibt sich der Wiener die Zeit mit Schnäppchenjagd. Allerdings tut man dies nicht mehr schaufensterbummelnd, sondern in ferngesteuerten Rollschuhen und surrenden Elektrowägelchen, oder automatisch fahrenden Kinderwagen hinterherflanierend. Auch Hunde hat der Mensch, echte und biotechnische. Konsumkritische Erzähler geleiten uns in eine Welt von digitalen Werbetafeln und Sommerschlussverkauf im Mai – auch das ist uns aus dem Jahr 2011 vertraut.
Diese Welt sehen wir abwechselnd durch die Augen der Mitglieder des !Frontblock!s, die, so der Erzähler, „die Einsamkeit und eine romantische Abstraktion von der Vorstellung über das Leben“ verbindet. Abgesehen davon könnten sie unterschiedlicher nicht sein:
Dorian ist arrogant, aufbrausend und hinter Frauen her. Mit seiner Partnerin Emma ist er seit der Geburt ihrer Tochter nicht mehr glücklich, jedoch ist er ihr „ausgeliefert“, weil ihr Vater seiner demenzkranken Mutter das Altenheim finanziert.
Werther ist unglücklich verliebt in Emma und hegt einen tiefen Groll auf seinen Freund, der diese nicht gut behandelt. Er unterstellt Dorian – im Gegensatz zu sich selbst – mangelnde Intelligenz. Das hält ihn aber nicht davon ab, etwa mit zwei verschiedenfärbigen Schuhen aus dem Haus zu gehen. Er ist ein Melancholiker in vergnügt quietschende Sneakers, führt eine imaginäre Liste von Wörtern, die er nicht mag, hält die Vorstellung für besser als die Realität und vermutet, dass uns jemand etwas ins Trinkwasser mischt, das unglücklich macht, um so unser Konsumverhalten anzuregen.
Don, der Schotte, hat alles, was auch nicht glücklicher macht: Übertragungsfolien zum Empfang des Suicid-Channels, wo man täglich unter drei Selbstmordkandidaten wählen kann, Aroma-Broadcasting und eine Fernbedienung zum Heranzoomen von Gesichtern. Dulcinea, seine Lebensgefährtin, ist eine Gummipuppe, deren „Treue, Verständnis, Bescheidenheit, bereitwillige Duldsamkeit“ er zu schätzen weiß.
Falstaff, der Vierte im Bunde, isst abwechselnd – notfalls auch Hundekuchen oder auf Mülldeponien gefundene Karamellriegel – und trinkt durch einen Schlauch am Becherhalter seiner Kappe montierte Softdrinks. Er ist stark übergewichtig, womit ihn die andren gern ärgern, sieht sich als von den Eltern ungeliebten Einzelkämpfer und heimlichen Chefideologen des !Frontblock!s und kompensiert seine nicht vorhandenen sexuellen Erfahrungen mit Geschichten, die er in seiner Zeit bei der Skin-Sekte erlebt haben will.
Jago, der Anführer der Gruppe, wurde eben aus dem Gefängnis entlassen. Eigentlich will er, scheint es, wie auch die anderen im Grunde nur funktionierende zwischenmenschliche Beziehungen führen. Als das mit seiner Schwester nicht mehr funktioniert – sieh hat während seines Gefängnisaufenthalts den schwarzen Amerikaner Tom und dessen Gitarre Roberta in der geschwisterlichen Wohnung und in ihrem Leben einquartiert – besorgt er sich eine Pitpullterrierhündin. Wenige Tage nach ihrem Einzug stirbt diese, woraufhin Jago (ein Stückchen Hund ist offenbar besser als gar keiner) ihre Pfote an seiner Gürtelkette trägt, um sie in schwierigen Momenten streicheln zu können.
Unter Jagos Anleitung verbreitet der !Frontblock! Angst und Schrecken und kritisiert das Leben, das Universum und den ganzen Rest – allerdings weder zielgerichtet noch sonderlich erfolgreich.
Seinen Showdown findet der Roman, als der !Frontblock! erst Tom entführt und dann Roberta anzündet und lyncht. Tom verschuldet aus Versehen Falstaffs Todessturz in einen Brunnenschacht und wird schließlich selbst gehängt, weil Jago anhand des abgegriffenen Bibelzitats „Auge um Auge …“ ausgleichende Gerechtigkeit verlangt.
Franz Nikolaus Bäckers Botschaft ist kaum verkennbar. Wir kennen unsere Zukunft, denn wir haben keine ist ein misanthropisch-pessimistischer Roman, der in der Zukunft spielt, dabei aber die gegenwärtigen Verhältnisse anprangert. Im so konsumdominierten wie sinnentleerten Jahr 2042 wollen schon „die Kinder das Leben so schnell wie möglich hinter sich bringen“: Alkohol mit 10, Marijuana mit 11, Sex mit 12, Seitensprung mit 13, und mit 14 „[ein] klaffende[s] Vakuum, weil sie schon alles ausprobiert haben“.
Die Namen der Charaktere sind der Literatur entlehnt: von Goethe bis Shakespeare, von Cervantes bis Wilde. Sie wollen postmoderne Versionen ihrer jeweiligen Vorbilder sein, was aber nicht immer gelingt. Wenn auch die Eigenheiten der Einzelnen sehr unterschiedlich sind, kommt das in ihren inneren Monologen kaum durch. So werfen sie gern mit Fremdwörtern um sich; Dorian etwa ergeilt sich an den „fruchtigen Pheromonen“ eines Mädchens und Werther fühlt sich vom Gang eines Passanten an „Elephantiasis tropica“ erinnert.
Auch andere Details wirken unnatürlich: „[…] leben nur mehr von den Erinnerungen an unseren revolutionären, progressiven, bahnbrechenden Aktionismus vergangener Tage. Der Rädelsführer, mein Bruder, atmet seit Jahren gesiebte Luft in der Strafanstalt […].“ Weder verwendet man im natürlichen Gedankenlauf dermaßen viele Adjektive noch erklärt man sich selbst in einer Apposition etwas Selbstverständliches wie die Tatsache, dass der Rädelsführer und der eigene Bruder ein und dieselbe Person sind.
Die Charaktere schreien einander in GROSSBUCHSTABEN an, und der Leser wird mitunter kursiv angesprochen. Auffällig ist dies etwa in der Beschreibung von Werthers Affinität zu Aromabüchern. Nachdem diese über eine Seite beschrieben wurden, schaltet sich ein Erzähler ein, der annimmt, seine Allwissenheit reiche über den Buchdeckel hinaus: „Ich habe gewusst, dass Sie an dem Buch jetzt schnuppern würden und hoffe, ihr [sic] kleiner Ausflug inspiriert Sie …“
Allerdings hatte ich bis dahin nicht an dem Buch geschnuppert; erst jetzt, im Nachhinein, mache ich es doch. (Eindeutig kein Aromabuch; nicht einmal eins von der Sorte, die neu besonders gut riechen. Die Müllhalden, von denen der Erzähler wünscht, ich würde sie mir vorstellen, rieche ich nicht.)
Ein weiterer sprachlicher Minuspunkt ergibt sich aus dem anscheinend nicht vorhandenen Lektorat des arovell-Verlages und der kreativen Auslegung der deutschen Rechtschreibung, Zeichensetzung und Grammatik.
Fazit: Die Idee war in Ordnung. Die Umsetzung mäßig.