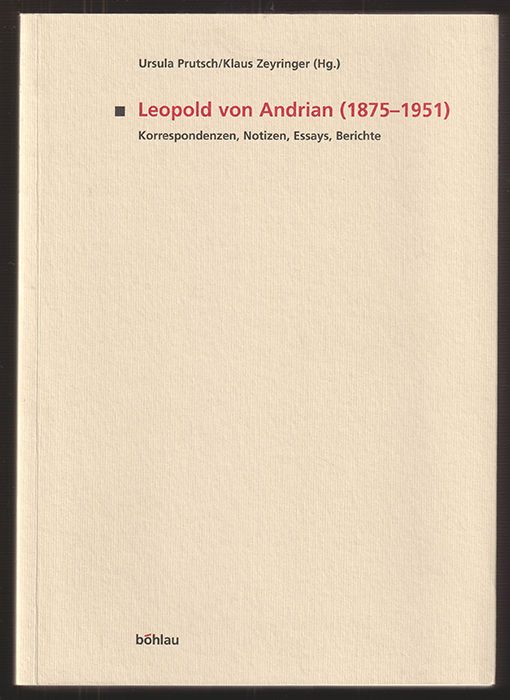Das Buch ist chronologisch geordnet; nach einer Darstellung der Nachlaßsituation (das umfangreiche, schwierig zu überschauende Material liegt im Deutschen Literaturarchiv in Marbach – Schande über das österreichische Staatsarchiv, das das Material in den späten 1960er Jahren nicht ankaufen wollte) wird Andrians Leben in sechs Abschnitten aufgerollt. Präzisen Einleitungen der Herausgeber, denen ihr germanistisches und historisches Wissen und Geschick (und nicht zuletzt ihr Einfühlungsvermögen in die gräßliche Handschrift Andrians) sehr gut zustatten kommt, folgen jeweils literarische Texte, Briefe und Dokumente in einer breiten Auswahl. Diese sechs Abschnitte sind:
1888 bis 1900: frühe literarische Arbeiten, „Junges Wien“ und französische Einflüsse aus labilem, unreif-frühvollendetem, selbstgefälligem, antisemitischem Blick; Ausbildung zum Juristen.
1900 bis 1914: Tätigkeit in verschiedenen Gesandtschaften des k.u.k. Ministerium des Äußern, zuletzt in Warschau.
1915 bis 1918: k.u.k. Vertreter im von deutschen Truppen besetzten Warschau; formuliert Kriegsziele für den Fall, daß Österreich-Ungarn siegreich aus dem Ersten Weltkrieg hervorginge; 1918/1919 Generalintendant der k.k. Hoftheater.
1919 bis 1938: Rückzug ins Privatleben, Staatsbürger Liechtensteins. Veröffentlicht die Schriften „Die Ständeordnung des Alls“ (1930) und „Österreich im Prisma der Idee“ (1936).
1939 bis 1945: Im Exil in Frankreich und Brasilien.
1946 bis 1951: Ausgedehnte Reisen; stirbt in der Schweiz, begraben in Österreich.
Was man dem Buch entnehmen kann, geht weit über das persönliche Mühen eines recht konservativen Kulturphilosophen und Autors von allerhand Unvollendetem hinaus; die Korrespondenzen und die kleineren Publikationen zeigen, wie sehr sich Andrian bemühte, als Zeuge der künstlerischen In-group der Jahrhundertwende aufzutreten; wie intensiv er seine diplomatischen und politischen Aufgaben wahrnahm, als es darum ging, die absinkende Monarchie in eine konstruktive Zukunft zu reißen; wie er für manche Katholiken und Konservative nach 1945 ein Moment der kulturellen Tradition bilden konnte, um, ähnlich motiviert (und ähnlich vergeblich) wie sein Mentor Hofmannsthal in den 1920er Jahren auf die Vergangenheit zu pochen („poeta austriacissimus“ 749).