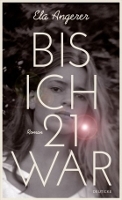Angerers Heldin überschreitet bei ihrer Suche nach sich selbst alle Grenzen. Sie verwahrlost im Überfluss einer absurden Welt ohne Liebe. Und so macht die junge Ich-Erzählerin Bekanntschaft mit allen Mitteln, die sie von der Wirklichkeit ablenken, ihr ein bisschen Zuhause versprechen und sie in eine bunte, weniger einsame und nicht gar so trostlose Welt entführen. „Als Kind nimmt man alles, was man an Zuwendung bekommen kann, und hört geduldig zu. Ja, man bemüht sich sogar, mit den richtige Zwischenfragen und guten Ratschlägen etwas Frohsinn in die schweren Köpfe dieser Menschen zu bringen.“ Denn „Erwachsene interessieren sich für uns [Kinder]. Nicht weil sie uns mögen, sondern weil sie einsam sind.“ Bei Ela Angerer interessiert sich aber letztlich kaum jemand wirklich für die Kinder. Sie sind umgeben von Wohlstand und auf sich allein gestellt. Die Mutter verreist lieber mit dem „Cadillacfahrer“, dem namenlosen Stiefvater. „Leider ist der Oktober die schönste Reisezeit, deshalb sind wir zu deinem Geburtstag nie da, sagte sie fröhlich“ und während die Mutter abwesend ist, wechseln die Kindermädchen, Köchinnen und Gärtner. Wir sind in den siebziger Jahren. „Man hatte Personal und noch keinen Krebs.“
„Mit dem Beginn der Farben in unseren Fotoalben wurden auch die Verhältnisse komplizierter, vor allem die der Frauen.“ Die Hausapotheken sind gefüllt mit Smarties-bunten Pillen. „Ihr fröhliches Aussehen versprach neue und bessere Zusammenhänge.“ Zumindest aber ergeben sie herrliche, aber gefährliche Cocktails. „Valium mit Sekt, Rohypnol mit Wodka, Imipramin mit Rum.“ Sie alle wollten ausprobiert werden. „Es war, als würde im Laufe der Zeit die ganze Welt um uns herum die Buntheit dieser Pillen annehmen.“
Aussichtslos, ohne Perspektive beschreitet die Heldin als Kind ihren Alltag mit einer ungeheuren Selbstreflexion und Tiefe, doch gleichzeitig genauso oberflächlich und absurd, wie die Welt, in der sie lebt und die sie beschreibt. Das ganze Leben als Flucht vor dem „Lieblichkeitsszenario“ in dem nur ein einziges Mal das Glück als Alltagsidylle aufscheint.
In Angerers Welt zählen Aussehen statt Identität, Schein statt Sein. Das junge Mädchen sieht kaum einen Sinn und Kafka als möglichen Ausweg. „Möglicherweise ergab also nichts einen Sinn, und diese Depression trieb die Welt in ihrem Inneren an. Darüber lohnte es sich nachzudenken.“
Als „Glaubenssatz“ der Romanheldin „[e]rst wenn es wehtut, wird es wirken“, steht der Schmerz am Anfang des Romans als trauriger Versuch, sich anzupassen. „Erst wenn es wehtut, wird es wirken“, wiederholt Angerer den Satz noch einmal in der Mitte ihres Romans und leitet damit eine neue, aber nicht minder grausame Welt des Internatslebens ein. „Ich wollte brav sein. Nein, falsch, ich wollte brav wirken, um nicht mehr ständig in der Schusslinie zu stehen. Niemand hier wusste etwas von mir. Das heißt, ich konnte noch einmal bei null anfangen.“ Doch auch diese Welt entbehrt der Liebe, der Geborgenheit und einer Zukunftsperspektive. „Die Drogen waren ab sofort mein Sport.“ Die Suche endet im Großeinkauf: „Schwarzer Afghane, Speed, LSD, Heroin und ein bisschen Gras“. Rauchen, Sex, Drogen, Alkohol und „demonstrativ zur Schau getragenes Selbstbewusstsein“. Ein junges Mädchen am „Anfang einer langen Testphase mit den unterschiedlichsten Mitten“. Und bei manch einem „[fühlte sich] mein Kopf auf den Fliesen […] nach Heimat an“.
Angerer zeichnet eine erschreckende Welt der Äußerlichkeiten und Befindlichkeiten, ohne Vorbilder, ohne Ziele und ohne Identität. Voller brutaler Ehrlichkeit, oft ironisch und distanziert, zuweilen auch kindlich und komisch beschreibt sie die Suche nach dem Selbst aus der Perspektive eines heranwachsenden Mädchens. „Eine Art Grundschuld schien mich zu umgeben. Ich war, so meine Überzeugung, ein schlechtes Kind, falsch und verlogen.“
Mit einer trügerischen Leichtigkeit erzählt Angerer sachlich, oft auch emotionslos, über Verletzungen, Ausgestoßen-Sein und eine schmerzhafte Identitätssuche. Wie eine Ohrfeige knallt sie Sätze aufs Papier, deren Wucht und deren tieferen Sinn der Leser erst merkt, wenn der Schmerz schon verklungen ist.