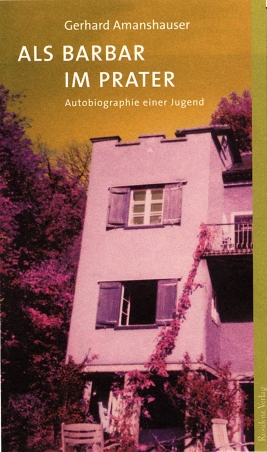Die gutbürgerliche Familie Amanshauser mit ihrer einsam auf halber Höhe des Festungsbergs liegenden Villa bei Salzburg war, es ist fast unnötig zu sagen, keine glückliche Familie. Aus den zwei Sätzen spricht auch die trotzige Einsamkeit des Kindes. Der Autor schreibt später im Buch von einer „eisigen Isolationsschicht“, die ihn umgab und von den andern trennte – ein einsames Kind war er. Die Isolationsschicht hat ihn jedoch auch davor bewahrt, ungebremst in den allgemeinen Begeisterungstaumel zu stürzen, als die braunen Uniformen 1938 Salzburg überfluteten.
Gerhard Amanshauser (1928) ist die bekannteste unbekannte Größe unter den österreichischen Gegenwartsautoren. Er wird trotz seines umfangreichen und beeindruckenden Werks noch immer als Geheimtipp gehandelt. Ein Grund dafür ist sicher sein eigenwilliger, sperriger Stil, der am Rande der literarischen Strömungen und Moden seine einsame Spur zieht. „Kein echter Schriftsteller ist da offenbar im Entstehen, sondern etwas ganz Seltsames“, schreibt Gerhard Amanshauer über sich selbst. Der Autor buhlt nicht um seine Leser. Seine „Autobiographie einer Jugend“, so der Untertitel des neuen Buches, erlaubt sich keine Sentimentalitäten, keine Abschweifungen. Amanshauser legt seine Kindheit, seine Familie unter dem Mikroskop frei und betrachtet sie mit Forscherblick. Unerbittlich streicht er beschönigendes Beiwerk weg. Die Szenen verknappen sich zu kurzen Skizzen, Momentaufnahmen einer Familienchronik. Man kann sehen, wie sich seine Figuren unter dem durch das Mikroskop ins Riesenhafte vergrößerten Auge des Betrachters winden.
Das Buch selbst scheint in die „eisige Isolationsschicht“ getaucht, die den jungen Amanshauser umgab. Eine Schlüsselszene dazu ist eine Passage gegen Ende des Buchs, als der Hitlerjunge Amanshauser als knapp 17-Jähriger an die Ostfront geschickt wird. Wozu weiß niemand mehr in diesen Tagen des „totalen Kriegs“, 1945. Kaum in Lodz angekommen, bricht die deutsche Front in sich zusammen, und alles rennt Hals über Kopf nach Westen. Jahre nach dem Krieg liest Amanshauser von einem Plan, die Aufseher der dortigen Konzentrationslager durch blutjunge, kampfunerfahrene Rekruten zu ersetzen, um jene anderen als besseres Kanonenfutter zu verwenden. „Was hätte ich damals getan, wenn ich wirklich als Bewacher in ein Konzentrationslager gebracht worden wäre?“, schreibt Amanshauser, „Auf keinen Fall hätte ich mich geweigert. Der Gedanke, man könne irgendeinen Befehl direkt verweigern, wäre mir nie gekommen. Mein Zustand war dumpf und fatalistisch, meine Resistenz bestenfalls passiv. Ich wusste nicht genau, was ein Konzentrationslager war, und auch von Juden hatte ich kaum Kenntnisse, die über das allgemeine Wissen aus der Propaganda hinausgingen. […] Ich wäre also zweifellos Aufseher geworden. Hätte mich irgendeine Erfahrung zur Besinnung gebracht? Ich fürchte, kaum. Vielmehr wäre ich, je nach Drastik der Erlebnisse, in eine mehr oder weniger dumpfe Stimmung verfallen und so etwas geworden wie ein Hund, dem man etwas anschafft. Notfalls hätte ich getrunken. Niemals wäre ich allerdings ein bereitwilliger Quäler geworden, und dass ich zugeschlagen hätte, kann ich mir nicht vorstellen. Doch geholfen hätte ich den Häftlingen vermutlich auch nicht, sofern ich meine Stellung dadurch gefährdet hätte. Ist es denkbar, dass mich ein Häftling durch Zureden zur Besinnung gebracht hätte? Das ist unwahrscheinlich, weil ich mir nie Gedanken über menschliche und politische Zustände gemacht hatte, und mir so jedes Fundament fehlte.“
Mitläufer und kein Held – Amanshausers Figuren haben nicht das Zeug zum Helden. Sie sind nicht besonders gut, nicht besonders schlecht. Sie sind wahrhaftig, wiedererkennbar, und das schmerzt, das Forscherauge des Autors tröstet nicht.
In Amanshausers Buch, das übrigens den irreführenden Titel Als Barbar im Prater trägt, sind Fotos eingestreut, Kindheitsfotos mit dem kitschigen Charme vergilbter Bilder. Kaum ein Autor könnte es wagen, sein Fotoalbum zu plündern, ohne seine Autobiographie damit ins Lächerliche zu ziehen. Nicht so bei Amanshauser, die Bilder mildern die Schärfe seines Blicks, die Strenge. Mit den verstreuten Schnappschüssen erlaubt sich der Chronist die versöhnlichste Geste im Buch, denn die Fotografien sprechen anders als der Autor auch von Hoffnung, Unschuld und Zukunft.
Gerhard Amanshauser verabschiedet sich von seinen Lesern mit einem Auszug aus einem Gespräch, das er mit seinem Sohn Martin führte, selbst ein Schriftsteller, wenn auch ganz anderen Stils und Inhalts: „Bergtouren und Literatur, das macht man so stufenweise. Sagen wir, du hast einen Zungenkrebs. Der Arzt sagt, schön schauts nicht aus, das Züngerl, kommens nächsten Monat wieder, wie müssen eine genauere Untersuchung machen. Beim nächsten Mal sagt er, schaut eh ganz gut aus, hat sich verbessert, ist vielleicht nimmer ganz so rot, wir müssen aber trotzdem. Die Ärzte haben ja immer so einen Panzer um, denen ist alles egal. Der einzige, der keinen Panzer hat, ist der Patient. Der Arzt sagt, wir müssen die Zunge herausnehmen. Für einen Schriftsteller wäre das oft günstig, oder für seine Zuhörer, ihm die Zunge möglichst früh abzunehmen.“