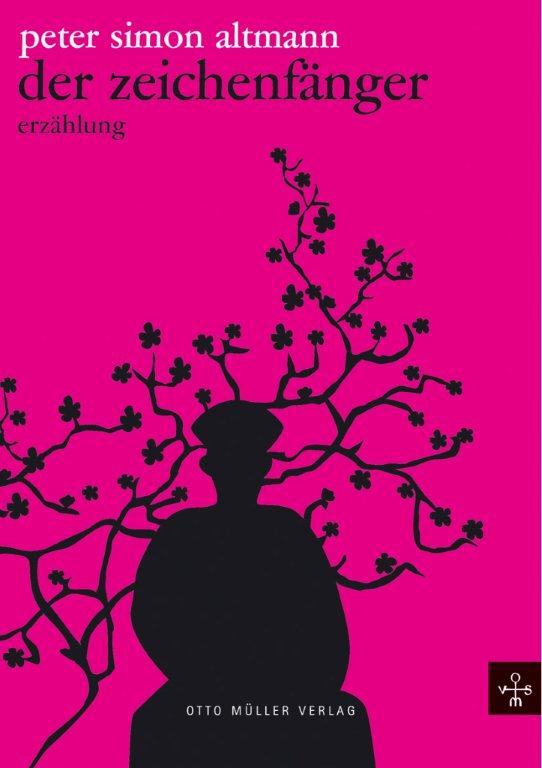Das kommt freilich nicht von ungefähr. Immerhin handelt es sich bei dem Ich-Erzähler um einen Universitätsassistenten, der auf dem Gebiet der chinesischen Schriftzeichen in der japanischen Sprache einschließlich ihrer Etymologie spezialisiert ist – ein Umstand, dem der Leser mindestens zweierlei verdankt: zunächst eine kurzweilige Einführung in die Ideographie zweier ostasiatischer Sprachen und schließlich einen Grundkurs in fernöstlicher Philosophie.
Vor diesem gelehrten Hintergrund ist die sparsame Handlung angesiedelt. Getragen wird sie von einem energielosen Wissenschaftler, dem sein Beruf nicht gerade viel abverlangt. Eine Vorlesung pro Woche und gelegentliche Mitarbeit an Forschungsprojekten lassen dem jungen Mann genügend Freiraum, um sich auf ausgedehnte Spaziergänge durchs nichturbane Wien zu begeben. Dabei durchstreift er Parkanlagen und Wälder, studiert deren Flora und Fauna und verliert sich in Meditationen über Werden und Vergehen allen Seins.
Kein Zweifel, das Leben ist unübersichtlich und mühsam! Was liegt also näher, als den Rückzug anzutreten. Wohlweislich verschreibt sich der sympathische Flaneur daher der Kontemplation, die er besser beherrscht als die vita activa. So ohrfeigt der ansonsten Sanftmütige einen drängelnden Fahrgast, zertrümmert im Zorn die Vitrine eines Palmers-Geschäftes und schleudert einem fremdenfeindlichen Proleten einen Stein ins Gesicht. Mit sich und dem Kosmos versöhnt, kehrt er nach vollbrachter Tat in die Gefahrlosigkeit der Innerlichkeit zurück, die ihm letztlich nicht behagt, weil „etwas“ fehlt. Was dies sein könnte, ahnt der versierte Leser bereits.
Seit der Erzähler von Aya, seiner japanischen Freundin, getrennt ist, zieht er nämlich durch Bars und besucht Massagesalons, wo er sich Berührungen mit geringem Befriedigungsfaktor erkauft. Gegen seine Fleischeslust und den genuinen Wunsch nach Zuneigung ankämpfend, wiederholt er sich tapfer sein persönliches Mantra: „Ich will der Trübung des Blicks, der Bestechlichkeit der Sinne endgültig entkommen.“ Beim Anblick eines mit einer Lotusblume spielenden Knaben scheint die Kehrtwende gelungen. Innere Ruhe macht sich breit. Statt Wollen herrscht nun Windstille der Seele. Darüber wölbt sich vorläufig der Himmel im Blau eine der „36 Ansichten des Fuji-Berges“ von Katsushika Hokusai.
Angenehm berührt mag der Leser nun den Band schließen und die feinen Naturdarstellungen, die an die Tableaus chinesischer und japanischer Meister erinnern, Revue passieren lassen, schmunzelnd über die unbezwingbare Libido des Protagonisten (nach Schopenhauer der stärkste Ausdruck des Willens zum Leben), der auch mit tiefgründigen Sentenzen auf Dauer nicht beizukommen ist.
Mit dieser Erzählung versucht der Autor, die Weisheit des Buddha auf den Alltag eines Wiener Intellektuellen zu übertragen, was ihm in der Tat gelingt. Wenngleich Der Zeichenfänger mit den Gebrechen unserer postmodernen Gesellschaft scharf abrechnet, umgeht er heiter und ironisch die Versuchung des Moralismus. Denn Altmann will die Welt nicht heilen und begnügt sich damit, Stimmungen einzufangen, wobei er angesichts des Unabänderlichen für Gelassenheit plädiert. Eine derartige Gestimmtheit ist auch beim Rezipienten von Vorteil, wenn er sich mit dem Buch auf Zeichenfang begibt.