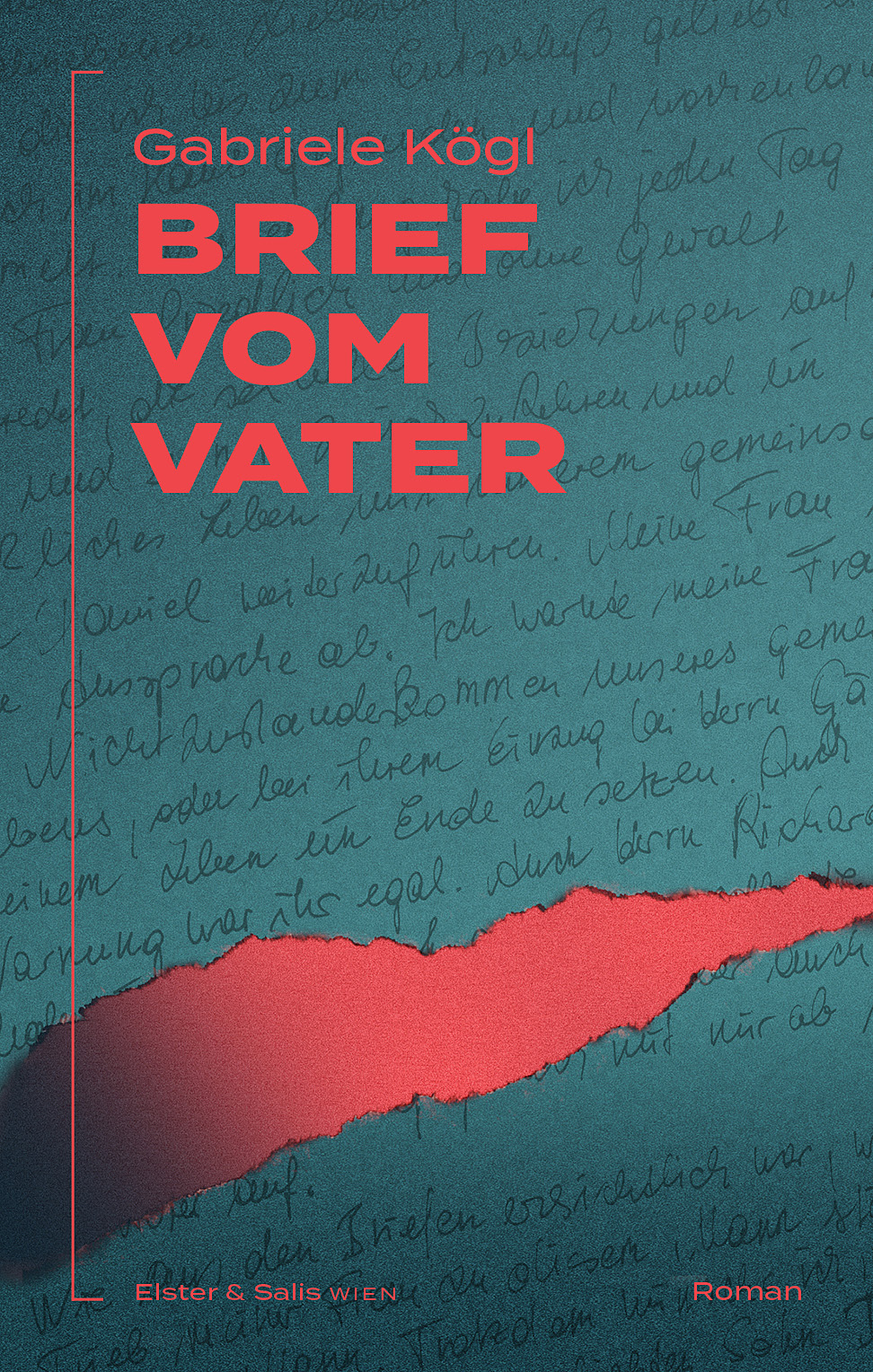Uns Leser:innen bleibt nichts erspart, was zur Conditio humana gehört: Suizid, Krankheit, Ausgrenzung, sozialer Abstieg, Hilf- und Sprachlosigkeit.
Auch die lange Tradition kritischer Heimatromane hat wenig daran geändert, wie das Leben in den Kleinstädten der Peripherie gesehen wird. Tourismuswerbung, Sehnsucht, dem Großstadtjungel zu entkommen und eine Tendenz, Probleme nicht wahrnehmen zu wollen, begünstigen ein allzu idyllisches Bild vom Leben auf dem Land. Erst seit kurzem wird in Zusammenhang mit der Problematik übermäßigen Bodenverbrauchs, der notwendigen Veränderung von Lebensweisen wegen der sonst unaufhaltbaren Klimaverschiebungen und korruptionsanfälligen Ortskaisern sensibler auf das Sterben kleinstädtischer Ortszentren und den Zerfall dörflicher und kleinstädtischer Strukturen geschaut.
Welche Konsequenzen solche Verschiebungen nach sich ziehen, können wir bei Gabriele Kögl nachlesen. Sie zeigt die wirtschaftlichen und sozialen Probleme des ländlichen Raumes ebenso, wie deren Auswirkungen auf einzelne Menschen. Diese enge Verknüpfung der Darstellung sozio-ökonomischer Veränderungen mit der Erfahrungswelt der in dieser Umgebung lebenden Menschen gelingt der Autorin besonders gut und eröffnet neue Einsichten und besseres Verstehen.
Das Buch beginnt mit dem Selbsttod des gelernten Tischlers und späteren Fernfahrers Severin. Er lebt im selben Haus wie seine Mutter Rosa. Ein Strang der Erzählung gilt Rosas Suche nach einer Erklärung für diese Handlung. Diese ist aber nicht der einzige Tiefpunkt, den Rosa aushalten und verarbeiten muss. Wie sie ohne Gejammere und vollständigen Zusammenbruch den Tod des Sohnes, die gescheiterte Ehe mit dem Schützenkönig Sigi, dem Vater Severins, den Krebstod des zweiten Partners Klaus, dessen Konkurs mit der geerbten Drogerie, den Absturz aus den bürgerlichen Verhältnissen und die damit einhergehende Ausgrenzung erträgt, wird glaubhaft und ohne psychologisierende Umschweife berichtet. Die Autorin versteht es dabei, in einer Art, zu der eine große Portion Humor gehört, zu erzählen, die zwar nachdenklich macht, aber nicht depressiv.
Es gibt zwei Briefe im Roman, die im Wortsinn lebensentscheidend sind. Da ist der im Titel genannte Brief vom Vater, der an Kafkas Brief an den Vater denken lässt. Ja, Sigi ist für Severin eine dominante Persönlichkeit, er ist ihm gegenüber unsicher und hegt Gefühle der Unzulänglichkeit. Dennoch gelingt es Gabriele Kögl, eine gewisse Spannung zu erzeugen, was denn nun im Brief tatsächlich steht, den die Polizei im Socken des Selbstmörders Sigi gefunden hat, und den Rosa Severin zum Lesen überließ. Der zweite Brief kommt von der Bank, er bedeutet für Klaus das Ende seiner Drogerie und den rasanten gesellschaftlichen Abstieg.
Besonders beeindruckend ist Kögls Fähigkeit, soziale Unterschiede in der ländlichen Bevölkerung differenziert und in ihren Auswirkungen auf die Lebensweisen einzelner Menschen aufzuzeigen. Sie führt dabei überzeugend und bewundernswert vor, wie Literatur selbst gutem Journalismus in der Darstellung komplexer Verhältnisse überlegen ist.
Es ist zu hoffen, dass niemand einen Brief wie im Titel erhält, in das Buch aber sollten möglichst viele Menschen hineinschauen.