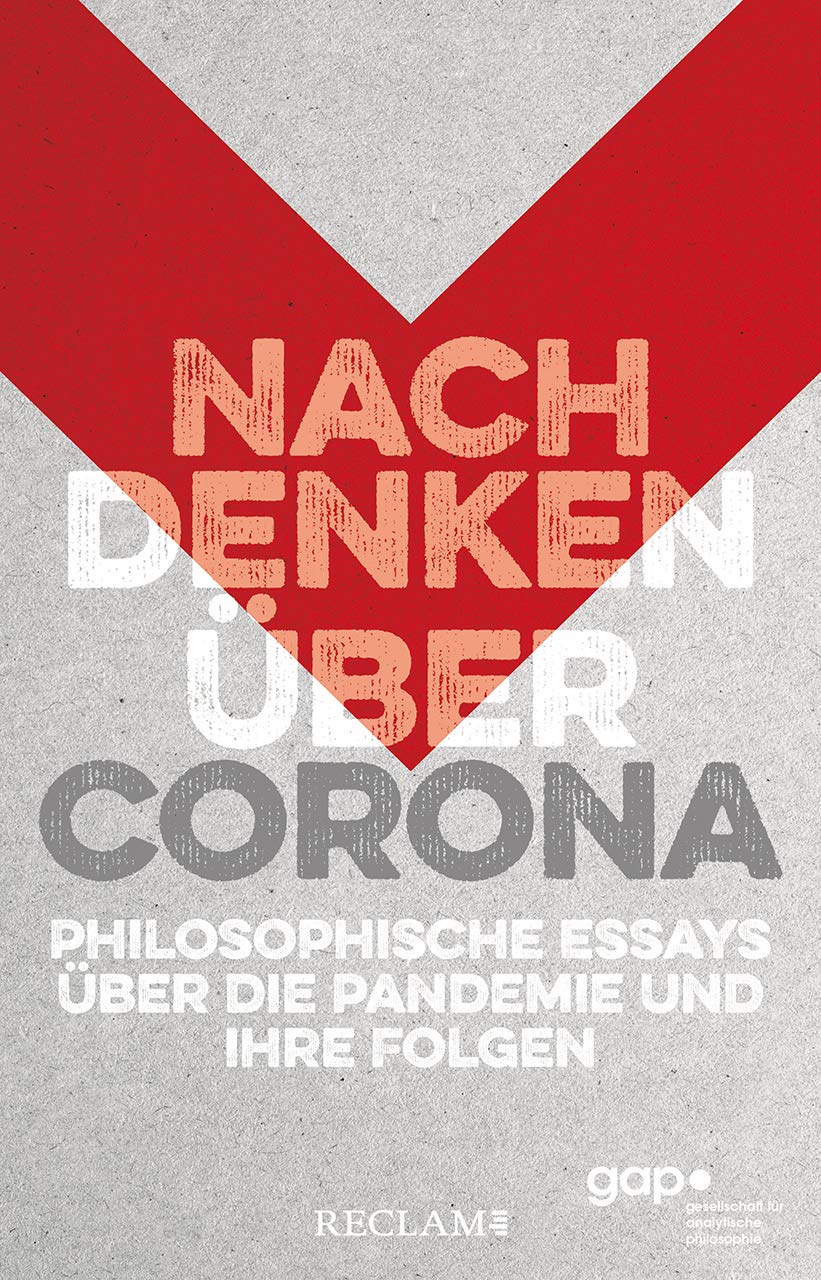Die mit Nachdenken über Corona recht allgemein und offen gehaltene Thematik des Wettbewerbs, die durchaus auch das Risiko der Beliebigkeit in sich birgt, hat in diesem Fall erstaunlich vielseitige und tiefschürfende Überlegungen zu Tage gefördert und außerdem den Vorwurf der Tagespresse, die Philosophie hätte zur Corona-Krise „außer Banalitäten“ (S. 10) nichts beizutragen, eindrucksvoll widerlegt. Und der, von den beiden Herausgeber*innen Geert Keil und Romy Jasters im Vorwort an die eigene Zunft gerichtete Appell „diejenigen Aspekte des Umgangs mit der Pandemie abzustellen, die nicht so schnell durch Tagesereignisse überholt werden“ (S. 11), hätte wohl keinen eindrücklicheren Widerhall finden können als durch die im Band versammelten Beiträge.
So setzt sich etwa der Gewinner des ersten Preises, Christian Budnik, in seinem Essay „Vertrauen als politische Kategorie in den Zeiten von Corona“ mit der durch die Pandemie hervorgerufenen Vertrauenskrise auseinander und unterzieht den Begriff Vertrauen einer philosophischen Reflexion, die ihn schließlich vor dessen unbedachter Verwendung als politische Kategorie warnen lässt. Anders als Naturkatastrophen wie Erdbeben oder Überflutungen weist die Corona-Krise laut Budnik drei besondere Merkmale auf: Sie bedroht erstens die Gesundheit aller Bürger*innen eines Staatsgefüges gleichermaßen, um sie zu bewältigen, sind zweitens die politischen Entscheidungsträger in höchstem Maße auf die „Kooperation aller Staatsbürger angewiesen“ (S. 22) und die mit ihr verbundenen Maßnahmen sind drittens besonders stark von den Ergebnissen wissenschaftlicher – vor allem medizinischer und epidemiologischer – Forschung abhängig. Voraussetzung für eine halbwegs gelungene Krisenbewältigung ist nun, dass jede*r einzelne Bürger*in auf das „richtige“ Verhalten von Politik, Wissenschaft und Mitbürger*innen vertraut. Doch mit Fortdauer der Krise wird dieses Vertrauen immer nachhaltiger erschüttert und schlägt schließlich in Misstrauen und Widerstand um. Einen Grund dafür sieht Budnik im problematischen Verständnis und der emotionalen Aufladung des Begriffs Vertrauen, weshalb so manche*r Bürger*in ausbleibende oder sich nur zögerlich einstellende Verbesserungen der Lage als Vertrauensbruch empfindet. Als einen möglichen Ausweg aus diesem Dilemma schlägt Budnik als Alternative den weit weniger emotional aufgeladenen Begriff der Verlässlichkeit vor. Denn „[w]er sich auf etwas verlässt, macht eine Annahme über die Zukunft, die sich bewahrheitet oder eben nicht“ (S. 29).
Auch die Gewinnerin des zweiten Preises, Luise K. Müller, zeigt in ihrem Essay „Das Samariterprinzip. Warum der Staat in der Not zwingen darf“ ein die Corona-Krise prägendes Schlagwort auf und entkräftet dieses mittels philosophischer Beweisführung. Die leider weit verbreitete Annahme, die staatlichen Vorgaben zur Eindämmung der Corona-Pandemie seien illiberal, basiert nämlich, laut Müller, auf der Unkenntnis liberaler Grundprinzipien, deren Freiheitsanspruch dort endet, wo dieser zur Gefahr für andere wird. Als Kronzeugen für dieses Prinzip zieht Müller niemand geringeren als John Stuart Mill heran, einen der wichtigsten Denker und Gründerväter des klassischen Liberalismus. Wenn somit Demonstrant*innen gegen staatlich verordnete Corona-Vorschriften mit Slogans wie „Nicht ohne uns!“ ihr Mitspracherecht einfordern und damit auf das Zustimmungsprinzip nach John Locke pochen, entlarvt Müller dieses nicht nur als „rekursive Schleife“ (S. 33), die immer wieder zu neuen und sich ständig wiederholenden Abstimmungen führen müsste, sondern auch als Gefahr für die allgemeine Gesundheit, da sich ja diejenigen, die den Pandemie-Bestimmungen die Zustimmung verweigern, auch nicht mehr an diese halten müssten. Müller plädiert hingegen für das Samariterprinzip, das es dem Staat im Sinne des Allgemeinwohls erlaubt, Zwangsmaßnahmen durchzusetzen, um z.B. – wie im Falle von Corona – das Ansteckungsrisiko zu minimieren.
Emanuel Viehbahn, der Gewinner des dritten Preises, widmet sich hingegen in seinem Beitrag „Lob der Vermutung“ der Neuperspektivierung eines – wie er argumentiert, zu Unrecht – als bedenklich eingestuften Sprechakts. Einleuchtend zeigt er auf, dass der Sprechakt der Behauptung in Krisensituationen zwar kurzfristig Sicherheit vermitteln mag, im Falle der Nichterfüllung der behaupteten Äußerung aber zu irreversiblen Schäden an der Glaubhaftigkeit des Sprechers führen kann. Viehbahn plädiert hingegen für den Sprechakt der Vermutung, der zwar auf den ersten Blick unklarer und schwächer als eine Behauptung erscheinen mag, auf längere Sicht den Sprechenden aber vor voreiligen Festlegungen und Spekulationen bewahrt. Somit strebt Viehbahn das ambitionierte Ziel an, mithilfe der „Sprachphilosophie einen Beitrag zum Umgang mit der Pandemie“ (S. 46) zu leisten. Um dies zu bewerkstelligen, widerlegt er zunächst gekonnt die gängigen Vorwürfe, Vermutungen würde es an Klarheit mangeln bzw. der Sprechende könne sich mittels ihrer Hilfe aus der Verantwortung stehlen. Um schließlich aufzuzeigen, dass von Expert*innen geäußerte Vermutungen in Krisensituationen seriösere Sprechakte darstellen als Behauptungen, weil sie erstens „eine schwächere Verteidigungsverantwortung mit sich bringen“ (S. 57) und es somit erlauben, „ungesicherte Hypothesen“ (S. 57) zu teilen und, weil sie zweitens „die Grenzen des Wissens signalisieren und dadurch Unklarheit vermeiden“ (S. 57).
Ähnliche Argumente für eine Begriffsschärfung und Differenzierung führt Oliver Hallich in seinem Beitrag „Verhindern oder Vorbeugen? Freiheitseinschränkungen in der Corona-Krise“ an. Da wir im alltäglichen Gebrauch die Begriffe „Prävention“ und „Prophylaxe“ oft synonym verwenden, plädiert Hallich für das Gegensatzpaar „Verhindern“ und „Vorbeugen“, um damit die Debatte um die zur Pandemieeindämmung erlassenen Freiheitseinschränkungen wesentlich zu entschärfen. Diese Begriffe unterscheiden sich schon allein aufgrund der zeitlichen Nähe zum bevorstehenden kritischen Ereignis (ein zu verhindernder Ernstfall steht weit unmittelbarer bevor als einer, dem vorgebeugt werden muss), aber auch aufgrund der Wahrscheinlichkeit des Eintretens, des kausalen Zusammenhangs zwischen Maßnahme und Wirkung, sowie der „kontrafaktischen Unterstellung des Auftretens des Schadens im Falle des Ausbleibens“ (S. 61) von verhindernden Maßnahmen. Basierend auf diesen Abgrenzungsmerkmalen fordert Hallich von der Politik eine deutliche Kennzeichnung von freiheitseinschränkenden Maßnahmen, die im Zuge der Pandemiebekämpfung verhängt werden, als vorbeugende bzw. verhindernde. Denn in einer „liberalen Demokratie“ sollte von „freiheitseinschränkenden Maßnahmen gefordert werden, dass sie die Rechtfertigungsstandards für einen Schaden verhindernde, nicht nur für ihm vorbeugend entgegentretende Maßnahmen erfüllen“ (S. 65). Und er warnt in diesem Zusammenhang eindrücklich vor den Gefahren einer ungekennzeichneten „Verschiebung der Rechtfertigungsbedingungen für Freiheitseinschränkungen“ (S. 71).
Auch Ludger Jansen beschäftigt sich in seinem Essay „Masken, Abstand, Anschnallpflicht. Freiheitseinschränkungen im Straßenverkehr und in der Pandemie“ mit den Auswirkungen und der öffentlichen Wahrnehmung von Freiheitsbeschränkungen. Sein Schwerpunkt liegt allerdings auf dem sogenannten „Präventionsparadox“, das besonders im Frühsommer 2020 in Erscheinung trat, und welches besagt, dass ein Erfolg, der sich durch bestimmte Maßnahmen einstellt, nicht als solcher erkannt wird und stattdessen die Angemessenheit und Wirksamkeit der Maßnahmen selbst infrage gestellt werden. Erhellend und argumentativ elegant vergleicht Jansen in diesem Zusammenhang die durch die Corona-Krise hervorgerufenen Regeln und Einschränkungen mit jenen, die im Straßenverkehr gelten. Kaum jemand bezweifelt, dass die sinkenden Zahlen der Verkehrstoten in den letzten Jahren auf die Einhaltung von Regeln wie Geschwindigkeitsbegrenzung oder Gurt- und Helmpflicht zurückzuführen sind. Dass nun im Sommer 2020 die Nachrichten über sinkende Sterbezahlen im Straßenverkehr als positiv wahrgenommen wurden, während jene über die sinkenden Corona-Infektionen Unmut und Ärger auslösten, erläutert Jansen geschickt mithilfe eines Vergleichs zwischen den beiden im Grunde gar nicht so unterschiedlichen Formen der Freiheitsbeschränkung. Und er plädiert schließlich für ein allgemeines Umdenken im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen, da „[i]n Zeiten der Pandemie gilt: Das Maskentragen stört nicht das Einkaufen, den Unterricht oder das Busfahren – es ermöglicht, diesen Tätigkeiten mit verringerter Infektionsgefahr nachzugehen“ (S. 82).
Mit einem dringlichen und hochgradig diffizilen Problem setzt sich Frank Dietrich in seinem Essay „Medizin am Limit. Wie umgehen mit Versorgungsengpässen in der Pandemie?“ aus einer ethischen Perspektive auseinander. Er unterzieht die von Gremien wie der Deutschen Bundesärztekammer (BÄK) und der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI) veröffentlichten Handlungsempfehlungen für medizinische Entscheidungsträger*innen einer ethischen Analyse und geht dabei der brisanten Frage nach, ob diese Vorgaben für Ärzt*innen, die im Falle von überbelegten Intensivstationen entscheiden müssen, welche Patient*innen eine Behandlung erhalten sollen, tatsächlich eine tragfähige Hilfestellung bieten. Dietrich beleuchtet insbesondere die Empfehlungen zur Ex-ante-Triage, bei der es um die Zuweisung freier Behandlungsplätze an bislang unversorgte Patient*innen geht, und jene zur Ex-post-Triage, bei der auch bereits intensivmedizinisch betreute Patient*innen in die Auswahlverfahren einbezogen werden. Dabei gelangt er für die Vorschläge, die zur Ex-ante-Triage gemacht wurden, zu dem Ergebnis, dass das aufgrund einer befürchteten Altersdiskriminierung vorgeschlagene Kriterium der Priorisierung nach „unmittelbaren Überlebenschancen der Patient*innen“ (S. 96) den Entscheidungsprozess für Ärzt*innen durchaus erschweren kann, da sie den Altersfaktor ausblenden müssen, während eine Ex-post-Triage wiederum „mit erheblichen psychischen Belastungen für die Entscheider“ einhergeht, weil diese gezwungen wären, die Behandlung bereits intensivmedizinisch betreute Patient*innen abzubrechen, um jenen mit besseren Erfolgsaussichten den Vorzug zu geben.
Eine völlig andere, aber um nichts unwesentlichere Fragestellung wirft hingegen Sebastian Schmidt in seinem Beitrag „Wie vernünftig sind Verschwörungstheoretiker? Corona und intellektuelles Vertrauen“ auf. Er unterwirft die von der modernen Psychologie vertretene These vom Menschen als „irrationalem Tier“ (S. 102) einer kritischen Prüfung und belegt anhand einer detaillierten Analyse der möglichen Verhaltensweisen von Menschen, die Verschwörungstheorien anhängen, dass deren Überzeugungen nur zu einem geringen Teil auf Irrationalität zurückzuführen sind. Dass Menschen nämlich dem sogenannten „Bestätigungsfehler“ (S. 99) aufsitzen, indem sie jenen Äußerungen glauben, die auch ihre bisherige Meinung bestätigen, Informationen selektiv auswählen und sich auch nur an jene Statements erinnern, die ihre eigenen Überzeugungen unterstützen, ist laut Schmidt keinesfalls „per se irrational, und es gibt damit keinen Grund, die intellektuellen Tugenden oder Fähigkeiten aller Menschen, die an Verschwörungsmythen glauben, kategorisch in Frage zu stellen“ (S. 108). Schmidt plädiert damit überzeugend für eine breit angelegte Dialogbereitschaft und für eine Beibehaltung des „intellektuellen Vertrauens“ gegenüber Andersdenkenden.
Alex Tiefenbacher unterzieht wiederum in ihrem Essay „Das Prinzip der Freiwilligkeit belohnt die Falschen“ das in Staaten wie Schweden und der Schweiz bevorzugte Prinzip der Freiwilligkeit einer kritischen Analyse. Und indem sie dessen Gelingen während der ersten Welle der Corona-Pandemie, dessen Scheitern beim Klimaschutz gegenüberstellt, zeigt sie gekonnt die Vor- und Nachteile einer staatlich nicht bis kaum sanktionierten Pandemie-Bekämpfung auf. Denn, obwohl das Prinzip der Freiwilligkeit bei den Bürger*innen natürlich viel beliebter ist als jenes des Verbots, sieht Tiefenbacher darin eine Ungleichbehandlung derjenigen, die sich an das Prinzip halten, verortet. Um diese zu veranschaulichen, thematisiert sie zunächst vier gesellschaftspolitisch problematische Punkte, die das Prinzip der Freiwilligkeit mit sich bringt: So kann etwa erstens nicht jeder Mensch durch freiwillige Kooperation dasselbe bewirken – die Initiativen von Großunternehmen beeinflussen Klimaschutz und Pandemiebekämpfung bestimmt nachhaltiger als die eines einzelnen Menschen. Zweitens muss den einzelnen Bürger*innen überhaupt einmal die Möglichkeit gegeben werden, freiwillig zu kooperieren, denn nicht jede*r verfügt auch über die entsprechenden finanziellen Ressourcen. Drittens wird je nach ökonomischer Situation den Einzelnen unterschiedlich viel abverlangt, denn in der Regel treffen Einschränkungen ärmere Bevölkerungsschichten härter als reiche. Und schließlich verlangt Freiwilligkeit auch einen Blick fürs Ganze, was heißt, dass die einzelnen Bürger*innen bei der Pandemie-Bekämpfung die „maximale Anzahl von Kontakten, die in einer Gesellschaft stattfinden können, ohne dass die Ansteckungszahlen explodieren“ (S. 115) mitberücksichtigen sollten. Wer sich nun all diese einschränkenden Maßnahmen freiwillig auferlegt, befindet sich, so Tiefenbacher, im Nachteil gegenüber denjenigen, die das nicht tun, und trotzdem von den positiven Effekten profitieren. Sie erachtet deshalb „[k]lare und verbindliche Vorgaben, die den Verzicht gleichmäßig auf alle verteilen“ als „fairer und zielführender“ (S. 120).
Schließlich gemahnt Yannic Vitz im letzten Beitrag des Bandes „Applaus, Applaus! Über die Ethik des Lobes und moralisch unangemessenen Applaus“ äußerst anschaulich zur Vorsicht vor der unreflektierten Bewertung eines kommunikativen Aktes, wenn auch in diesem Fall eines nonverbalen. Indem er den demonstrativen Applaus für Menschen in systemrelevanten Berufen während der ersten Welle der Corona-Krise im Frühjahr 2020 als Beispiel für eine Ethik des Lobes anführt, zeigt Vitz deren, im Vergleich zur Ethik des Tadels, geringe Resonanz in der gegenwärtigen philosophischen Debatte auf. Besonderes Augenmerk legt er dabei auf die problematischen Formen des heuchlerischen Lobs bzw. heuchlerischen Tadels. So ließe sich etwa der Applaus des britischen Premierministers Boris Johnson für das medizinische Personal, deshalb als heuchlerisch einstufen, weil er im Kontrast zu seinem „Verhalten als Parlamentarier stand, das nicht auf eine unterstützende Haltung gegenüber dem Personal des National-Health-Services hindeutete“ (S. 123). Lob verhält sich aber, so Vitz, nicht unbedingt analog zu Tadel: Während Letzterer darauf basiert, dass der Tadelnde selbst, das Verhalten, das er anprangert, nicht an den Tag legt, kann Lob durchaus denjenigen gespendet werden, die eine Leistung erbringen, die der Lobende selbst, nicht zu erbringen vermag, weil er z.B. keine medizinische Ausbildung besitzt und so nicht in systemrelevanten Berufen arbeiten kann. Die Motive einer Ethik des Lobes können somit durchaus komplexer sein als jene des Tadels. Lob erfüllt außerdem eine „wertvolle moralische Funktion und ist […] Baustein einer interpersonalen Moral zur Regulierung unseres Miteinanders“ (S. 131).
Alles in allem kann der in diesem Sammelband gewährleistete kaleidoskopische Überblick über die verschiedensten, philosophischen Termini und deren Beitrag zur Bewältigung der Corona-Pandemie, nicht hoch genug eingeschätzt werden. Mit all seinen vielschichtigen Perspektiven auf die gesellschaftspolitischen Herausforderungen, vor die uns die gegenwärtige Situation stellt, kann Nachdenken über Corona als ein wesentliches und vor allem nachhaltiges Desiderat bezeichnet werden, dessen Erkenntnisse und Überlegungen mit Sicherheit über die Krise hinaus Bestand haben werden.