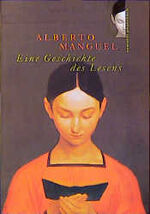Das Buch hebt an mit der Beschreibung einer Reihe von kunsthistorischen Leserbildern – die lange Tradition der Gemeinschaft der Leser symbolisierend -, deren analysierte Details an den leider sehr schlechten und miniaturisierten schwarz-weiß Reproduktionen kaum nachvollziehbar sind. Ohne Übergang folgt eine Reminiszenz auf Manguels „persönliche Geschichte als Leser“ (S. 33), in der er dem Klischee der Erleuchtung eine weitere Variante hinzufügt. Denn verglichen mit anderen Künsten hat die Kunst des Schreibens und Lesens – trotz aller berechtigten Klagen über primären wie sekundären Analphabetismus – in unseren Breiten die geringsten Zutrittsschranken. Das hat die Vertreter dieser Zunft immer schon besonders anfällig dafür gemacht, ihren individualgeschichtlichen Eintritt in das Reich der Schrift zu einem besonderen Moment der geheimnisvollen Initiation zu stilisieren. Wer an dieser Stelle befürchtet, Manguel würde die Tatsache, daß er in seiner Jugend zwe Jahre lang Vorleser bei dem erblindeten Jorge Luis Borges war – ein Aspekt der in Zeiten ausufernder Prominentenklatschecken und des Reality-TV auf einfachere Gemüter schon als solcher seine Wirkung tut – auf den vierhundert folgenden Seiten hemmungslos ausschlachten, wird aber angenehm überrascht. Um Geschichten nach der Formel „mein Leben mit berühmten Dichtern“ geht es Manguel in keiner Weise. Selbst im Kapitel über das Vorlesen übergeht er diesen autobiografischen Aspekt mit vornehmem Schweigen zugunsten der Institution der Vorleser bei den kubanischen Zigarrenarbeitern im 19. Jahrundert, bei den gemeinsamen Mahlzeiten der Benediktiner, die Benedikt von Nursa im 6. Jahrhundert einführte, in den Spinnstuben des Mittelalters oder den Tavernen und Herbergen, wie sie im Don Quijote verewigt sind.
Die dritte und letzte Hürde schließlich ist der Titel. Wer eine Geschichte des Lesens erwartet, wird das Buch vielleicht enttäuscht zur Seite legen. Auch die Gliederung in zwei große Abschnitte („Akte des Lesens“ und „Die Macht des Lesers“) ist trügerisch, denn der vorgegebenen Logik unterwerfen sich die einzelnen Abschnitte nicht. Wer sich auf eine üppig wuchernde Sammlung von Anekdoten, Erinnerungsbilder und Geschichten aus der Geschichte des Lesens einstellt, wird mit wachsender Lust den sprunghaften Gedankengängen und oft disperaten Erzähleinsätzen folgen und so eine Fülle von Details und wissenswerten Kleinodien bergen. Bei keinem der Kapitel geht es um Systematik, Chronologie oder Vollständigkeit. Als Subtext liest man mit, was dem Autor gefällt, was ihn fasziniert und daher eine besonders ausführliche, mitunter auch ausufernde Darstellung erfährt, wie etwa die – durchaus spannende – Fallstudie über das Schreibbuch des jungen Humanisten Beatus Rhenanus und die damaligen Zustände an der Lateinschule zu Schlettstadt, die den Kristallisationspunkt des Kapitels „Lesen lernen“ bilden. Ein Großteil der Kapitel ist nach diesem Prinzip der Kristallbildung strukturiert: ein Aspekt, ein literarisches Beispiel wird herausgegriffen und eine mehr oder minder große Zahl von ergänzenden Beispielen, Vorgeschichten und Nachwirkungen werden angelagert. Das Kapitel „Einsames lesen“ nimmt so seinen Ausgang bei Colette – vielleicht ist es auch deren Vorliebe für das Lesen im Bett, weshalb sich hier zwar eine kleine Kulturgeschichte des Bettes und der Lesebeleuchtung findet, nicht aber eine solche der Sitzmöbel. Beim (überraschend kurzen) Kapitel „Metaphern des Lesens“ steht Walt Whitman im Mittelpunkt (angehängt ist eine kurze aber köstliche Geschichte des diätetischen Vokabluars im Zusammenhang mit dem Buch), bei „Der Übersetzer als Leser“ ist es Rainer Maria Rilke, der Abschnitt „Die fehlende erste Seite“ steht im Zeichen Franz Kafkas, die Präsentation des „Büchernarren“ beginnt mit der Geschichte der Brille – seit Albrecht Dürers Holzschnitt zur ersten Narrenfigur in Sebastian Brants Narrenschiff ein Symbol des Lesers – und das Kapitel „Lesen hinter Mauern“ konzentriert sich auf die schreibenden Hofdamen im Japan des späten 10. Jahrhunderts. Besonders eindringlich ist etwa das Kapitel über Babylon und die Macht der mesopotamischen Schreiber mit einer Art Reportage aus einer mesopotamischen Schreibschule (S. 211ff.).
Nicht immer ist es der Neuigkeitswert, der im Vordergrund steht, sondern einfach die lustvolle Neupräsentation und sehr individuelle Zusammenschau bekannter Fakten, etwa über den allmählichen Übergang vom lauten Lesen zur „unüberwachten Kommunikation“ (S. 67) mit dem Buch durch stummes Lesen, über die Geschichte der antiken Bibliotheken und die Erfindung des alphabetischen Katalogs durch Kallimachos oder über die Metamorphose der Schrifträger von den Tontafeln zu den Textschlangen der Schriftrollen, den ersten Kodizes und der wechselnden symbolischen Bedeutung ihrer Formate.
Im Abschnitt über die Geschichte der neurolinguistischen Erklärungsversuche des Zusammenhangs von Gehirn und Sprache beschreibt Manguel das „rete mirabile“ oder „Wundernetz“, ein Geflecht aus winzigen Gefäßen an der Gerhirnbasis, mit denen sich mittelalterliche Forscher das Zustandekommen der Sinneswahrnehmung zu erklären versuchten (S. 44).
Gespeist von seiner Liebe zum Buch legt Manguel gleichsam eine Art rete mirabile aus sehr persönlichen Gedanken und schönen Sprachbildern zur Lesekultur über das ganze Buch. Nur in wenigen Fällen scheint er dabei etwas über das Ziel hinauszuschießen. Etwa wenn er die mnemotechnische Leistung der mittelalterlichen Gelehrten rühmt, die die „Seiten der Bücher, die sie gelesen hatten, […] noch Jahre später in sich wachrufen [konnten] wie ein Gespenst“ (S. 78) oder wenn die wuchernde Talmudliteratur zur „sich selbst regenerierende(n) Textsammlung“ mutiert – aber das könnte auch zu Lasten der Übersetzung gehen. Sie soll von Chris Hirte stammen, was dem Buch selbst allerdings nicht zu entnehmen ist. Manguel übernahm (von Borges) die Gewohnheit, auf das Vorsatzblatt am Ende des Buches Notizen und Verweise anzubringen. Das dürfte er mit vielen Lesern teilen. Nicht jedoch das leicht schlechte Gewissen, das seine Wertschätzung des Buches in der sympatischen Formulierung „von einem Buch hinter seinem Rücken zu sprechen“ (S. 29) zusammenfaßt.
Was Manguels Buch trotz dieser rückhaltlosen Bibliomanie gänzlich fehlt, ist die Endzeitstimmung angesichts der neuen Technologien. In den eingestreuten autobiografischen Bemerkungen gibt sich Manguel als aktiver Benutzer und Profiteur von Computer und Internet zu erkennen, der sich mit Verweis auf analoge Medienwechsel – von der Schriftrolle zum Kodex oder der Handschrift zum Buchdruck – von apokalyptischen Tendenzen distanziert, im übrigen scheint ihn diese Problematik überraschend wenig zu interessieren.
Das einleitende und das gesamte Buch prägende Bekenntnis Manguels lautet: „meine feste Heimatstatt waren die Bücher“ (S. 20). „Die beste Definition von Heimat ist Bibliothek“, heißt es in Elias Canettis Roman Die Blendung. Daß Manguel Canetti als wahren Buchfreund im Geiste noch nicht kennengelernt hat – zumindest wird er in seinem Buch mit keinem Wort erwähnt – ist für beide Teile bedauerlich, bei einem manischen Leser wie Alberto Manguel wird diese Bekanntschaft aber früher oder später zweifellos erfolgen. Vielleicht wird davon bald zu lesen sein, denn im „Nachsatz“ listet Manguel eine Fülle von weiteren Aspekten der Lesekultur auf, ausgeschmücktt und dargestellt in einem imaginierten Buch, das zumindest in der Vorstellung des Autors bereits existiert.