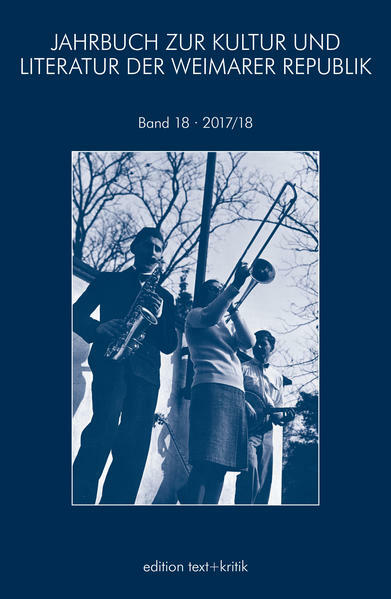Diesen begleitet Harald Tausch nicht nur mit einem ausführlichen Kommentar, sondern er kontextualisiert die Texte mit den Traumdiskursen der Zwanzigerjahre und schlägt dabei mit Blick auf Erich Kästners Fabian und Marie-Luise Kaschnitz‘ Liebe beginnt Traumprotokolle „als eine Gattungsinnovation der Zwischenkriegszeit“ (S. 22) vor; dafür ließen sich weitere Textzeugnisse finden. Tausch gelingt es, Hartlaub, dem Psychoanalytiker Ludwig Binswanger nahestehende Ehefrau des Kunsthistorikers Gustav Friedrich Hartlaub und Mutter zweier Schriftsteller, in einem produktiven Spannungsfeld von Literatur, Psychoanalyse und Gesellschaft zu präsentieren und sie so erstmals literarhistorisch greifbar zu machen.
Die daran anschließenden, in Umfang und Ausrichtung divergierenden Beiträge verdeutlichen die thematische Breite des Jahrbuchs. Gérard Raulet setzt sich mit dem Theologen, Kulturphilosophen und nach 1918 nicht unumstrittenen engagierten Demokraten Ernst Troeltsch auseinander, als Bezugspunkt dienen ihm vor allem die sogenannten Spectator-Briefe, 1919/20 (und nicht bis Juli 1929, wie es eine irrige Angabe glaubhaft macht) in der Zeitschrift Der Kunstwart und Kulturwart erschienen und seit 2015 auch als Teil der Kritischen Gesamtausgabe vorliegend. Im Vordergrund der Betrachtungen steht das Spannungsverhältnis von publizistischer Aktualität und philosophischer Reflexion auch im Sinne der bereits von Johann Hinrich Claussen thematisierten Übertragung ‚journalistischer Positionen‘ ins philosophische Konzept, die eine Lektüre der zunächst anonym publizierten Briefe als „praktische Seite des ethischen Engagements“ (S. 85) vorschlägt (obwohl Raulet selbst mit historischer Exaktheit beinahe zu einer vorrangig tagespolitisch orientierten Lesart verleitet). Auch Christian E. Roques zeigt am Beispiel des Soziologen und Stichwortgebers der konservativen Revolution Hans Freyer das zeitgenössische Zusammenspiel von Philosophie, Politik und Gesellschaft auf, wenn er über Freyers anhaltende Auseinandersetzung mit der politischen Romantik einen „privilegierten Zugang zu den politischen Mentalitäten der Zeit“ (S. 109) eröffnet und dabei nebenher Freyers Abgrenzung von dem in Wien lehrenden Vordenker des Ständestaats Othmar Spann thematisiert. Einblicke in die Mentalität der Zeit gewährt ebenso Stefan Tuczek, der den Kältekult als zentrales Denkmotiv in großer Breite in der Kunst, Wissenschaft wie auch im Alltag (bis hin zum Kühlschrank, der zum üblichen Haushaltsgegenstand wird) verankert sieht und ihn literarisch, an Helmut Lethen anknüpfend, in Gabriele Tergits Käsebier erobert den Kurfürstendamm wie in Stefan Zweigs literarischer Biografie des französischen Politikers Joseph Fouché nachweist. Auf den ersten Blick einen Gegenpol zu diesen den zeitgenössischen Denkweisen verschriebenen Diskursen bilden die von Clemens-Carl Härle knapp präsentierten Raumzeitfiguren Walter Benjamins, die um die „Inaktualisierung einer aktuellen Gegenwart“ (162) bemüht sind und dem Autor im Anschluss an Husserl in der Form der Gestalt von Loggia, Passage und Kristall als „Inaktualitätsmodifikationen“ (S. 160) erscheinen.
Günther Helmes präsentiert in seiner Darstellung filmischer Inszenierungen des Ersten Weltkriegs der Jahre 1916 bis 1937 mitunter erst wieder zugänglich gemachte Titel und rückt dabei konsequent die (gesellschafts-)politischen Produktions- sowie Rezeptionsbedingungen in den Fokus. Das Spektrum des materialreichen Beitrags reicht von patriotischen und militaristischen Kurzfilmen, die bereits während des Krieges entstanden sind und einen dem Kriegsverlauf geschuldeten „visual turn“ (S. 67) der deutschen Kriegsführung markieren, bis hin zu internationalen Dokumentationen und Spielfilmen der Zwischenkriegszeit. Darunter befindet sich auch der 1931 uraufgeführte Streifen 1914. Die letzten Tage vor dem Weltbrand des seit 1912 in Berlin wirkenden gebürtigen Wieners Richard Oswald, der auf die Darstellung des Historikers Eugen Fischer aufbaute und nicht zufällig nachträglich den Untertitel Ein Film gegen die Kriegsschuldlüge erhielt. Eine eingehende Analyse erfährt der 1930 wenige Monate vor der Oscar-prämierten US-Verfilmung von Im Westen nichts Neues veröffentlichte Film Westfront 1918, der vom Wahnsinn des Krieges zeugt. Das von Oswalds Nero-Film AG produzierte Tonfilmdebüt Georg Wilhelm Pabsts, der zuvor Hugo Bettauers Freudlose Gasse verfilmt hatte, wurde unter anderem von Alfred Kerr und Siegfried Kracauer für seine realistische Darstellung gewürdigt, erreichte jedoch keinen Publikumserfolg.
Von der nicht unmaßgeblichen Präsenz österreichischer Kunstschaffender in der deutschsprachigen Literatur und Kultur zwischen 1918 und 1933 zeugen zwei weitere Beiträge. Christopher Meid präsentiert die in der angloamerikanischen Forschung wiederholt thematisierte, im deutschsprachigen Raum aber weitgehend vergessene Anthologie Afrika singt, herausgegeben von der in Galizien geborenen Anna Nußbaum, die mit Hermann Kesser, Anna Siemsen und Josef Luitpold Stern auch die Übersetzung besorgte. Es handelt sich dabei um ein maßgebliches Zeugnis der afroamerikanischen Emanzipationsbewegung der 1920er und dient zugleich als Beispiel „für den Kulturtransfer zwischen dem deutschsprachigen Raum und der afroamerikanischen Literaturszene“ (S. 168), das die Lyrik der Harlem Renaissance in den feuilletonistischen Diskurs in Wien und Berlin einführte. Zumindest kurzzeitig erzielte die 1929 bei Speidel publizierte Anthologie „shockwaves“ (so Hilde Spiel später) in intellektuellen Kreisen, neben Kurt Tucholsky würdigten unter anderem auch Else Feldmann in der Arbeiter-Zeitung und Ernst Lothar in der Neuen Freien Presse das Werk mit ausführlichen Besprechungen. Die Rezensent/innen erkannten vor allem die „erzieherische Macht“ (Lothar) abseits der primitivistischen und exotistischen Inszenierungen des Fremden, die Nußbaums Kompilation ebenso wie die Reiseberichte der Zeit potenziell aufwies. Zugleich grenzte sie sich, wie Meid zeigt, deutlich von anderen Förderern afroamerikanischer Lyrik ab, denn Nussbaum versuchte nicht, sie in die angloamerikanische Literatur zu integrieren, sondern setzte die „Rassenzugehörigkeit [als] wesentliche[n] schöpferische[n] Antrieb“ (S. 172). Sie nutzte nicht nur biologistisches Denken zum Abbau von Vorurteilen, sie wendete das Rassenproblem zum Klassenproblem und nahm in ihrem Vorwort die Situation der Afroamerikaner zum Ausgangspunkt für Fragen um Rasse und Identität, Marginalisierung und Ausgrenzung. Nicht zufällig schrieb Martha Weltsch in der Jüdischen Rundschau im Februar 1929, kein Zionist würde das Buch „ohne tiefe Erschütterung“ lesen.
Karoline Sprenger (mittlerweile Hillesheim) wiederum erinnert an die wenig beachteten späten Dramen Ödön von Horváths Figaro läßt sich scheiden und Don Juan kommt aus dem Krieg, sie dienen ihr jedoch nur als Brücke zur Mozart-Rezeption im Volksstück Kasimir und Karoline. Den Schauplatz Münchner Oktoberfest erklärt sie, wie bereits Hellmuth Karassek, zum Laboratorium, und Mozarts Cosi fan tutte sieht sie „in der Tradition“ als das einzige Werk, das „ebenso stringent mit menschlichen Gefühlen und Schwächen“ (S. 191) experimentiert. So schwer haltbar dieser Befund in seiner Ausschließlichkeit erscheint, so produktiv erweist sich die Kontrastierung mit Mozart mit „erhebliche[n] Unterschiede[n]“ (S. 194) wie „frappierende[n] Entsprechungen“ (S. 195). Sprenger erkennt in Cosi fan tutte nicht bloß den Einfluss einer Oper, wie er vielfach in Horváths Werk festzustellen ist, sondern schreibt ihr in Horváths Interpretation des Volksstücks als demaskierende Form des „prononcierten Vorzeigens“ (S. 191) entscheidende Bedeutung zu.
Den Abschluss des Bands bildet eine knappe, auf Forschungsdesiderate noch allzu vorsichtig hindeutende „Nebenbemerkung“ Walter Delabars und Ines Schuberts zur Anzahl der Schriftsteller/innen der Weimarer Republik, die sie als Indikator sowohl für die im internationalen Vergleich hohe „Produktivität im Literaturbetrieb“ als auch insgesamt für die „Entwicklung der Autorschaft“ (S. 205) deuten. Die Hochrechnung auf 23.000 Autor/innen legt jedenfalls den Verdacht nahe, dass auch die nächste Ausgabe des Jahrbuchs auf ansprechendes Material zurückgreifen kann, das auf profunde Bearbeitung wartet.