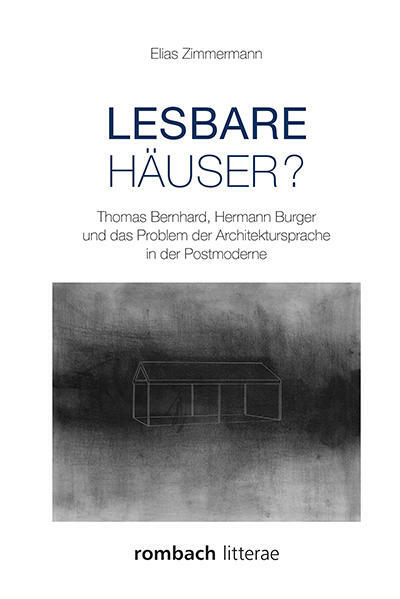Schon der Titel problematisiert mit seinem Fragezeichen einen Vorgang, der oft als selbstverständlich erachtet wird: die Lesbarkeit der Architektur. Eine solche Analogie zwischen Architektur und Sprache wird zum einen in der neueren Architekturtheorie skeptisch betrachtet, zum anderen in der Sprachphilosophie, etwa bei Wittgenstein oder Heidegger, kritisch reflektiert. Der Verfasser vorliegender Studie macht es sich nun zur Aufgabe, das „Verhältnis von architektonischer Ästhetik und Sprachphilosophie“ (S. 36) erstmals von einem literaturwissenschaftlichen und metaphorologischen Standpunkt aus zu analysieren.
Er wählt für dieses Unterfangen zwei Texte aus, die zeitnah veröffentlicht wurden und in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur eine herausragende Position einnehmen: Thomas Bernhards Korrektur (1975) und Hermann Burgers Schilten. Schulbericht zuhanden der Inspektorenkonferenz (1976). Diese Konzentration auf zwei Werke, die inhaltlich und formal eine große Affinität aufweisen, hat gegenüber einem breiter gefächerten Analysekorpus den Vorteil, dass sie sowohl ein close reading als auch eine angemessene Auseinandersetzung mit der einschlägigen Sekundärliteratur ermöglicht. Gerade solch genaue Lektüre befähigt den Verfasser, vorschnelle und pauschale Urteile bezüglich der Bedeutung von Architektur in diesen literarischen Texten zurückzuweisen.
Zunächst besteht er auf dem ästhetischen Unterschied zwischen den beiden Künsten: „Die Ästhetik eines geschriebenen Raumes ist nicht die Ästhetik eines gebauten Raumes, und eine architektonische ist keine literarische Skizze […].“ (S. 48) Das klingt wie eine Binsenweisheit, doch wird sie in der Auseinandersetzung mit der literarischen Architekturdarstellung immer wieder ignoriert, wie der Verfasser an mehreren Beispielen aus der Sekundärliteratur zeigt. Zu solcher Gleichsetzung verleitet die in Korrektur wiederholt genannte „Entsprechung“ von architektonischen Räumen und Figuren. Zimmermann betont zurecht: „Der Raum bleibt trotz gegenseitiger Bedingtheit von der Figur unterscheidbar, woraus grundlegende Spannungen zwischen Raum und Figur entstehen.“ (S. 57) Eine solche Spannung entsteht in Korrektur auch zwischen dem Gelingen der Architektur des Kegels und dem Versagen seiner literarischen Beschreibung. Und diese Kluft wird durch eine weitere Ambivalenz überlagert: Während die Konstitution von (architektonischen) Räumen in der Regel durch subjektive Wahrnehmung erfolgt und daher die Entsprechung von Raum und Figur permanenter Veränderung unterworfen ist, lässt das perfekte Bauwerk die Architektur und ihre Wahrnehmung erstarren und führt zum Tod. Damit wird aber auch ein wirkmächtiger Mythos der Moderne widerrufen: der des Architekten als „selbstbewussten Konstrukteur von Raum und Mensch“, seine Rolle als „Lebensarchitekt“. (S. 83)
In Zimmermanns erhellender Lektüre zeigt sich Korrektur als Echo auf eine schon seit dem Ende des 19. Jahrhunderts mit August Schmarsow einsetzende Konzeption von Architektur als Raumkunst: Sie erscheint als Produkt subjektiver Empfindung – und diese umgekehrt als Produkt der Architektur. Damit wird Architektur zu einem Ereignis, das nur erlebbar, aber nicht sag- und lesbar ist. Der Verfasser macht die Kluft zwischen Schrift und Architektur am Beispiel der Physiognomik deutlich, die sich schon bei Lavater vor das Problem der Nichtabbildbarkeit der beobachteten Objekte durch die Schrift gestellt sah. Diese Diskrepanz rekonstruiert der Verfasser auch anhand von Wittgensteins letzter Schrift Über Gewissheit: „Die Zeichenphysiognomie markiert […] die undurchdringliche Grenze zwischen Regelgebrauch und privatem Empfinden und damit die Grenze der Mitteilbarkeit von Bedeutung überhaupt.“ (S. 189) Er bringt abschließend Hans Blumenbergs Begriff der Sprengmetapher ins Spiel: Die „symbolisch-geometrische Verweisfunktion“ von Roithamers Kegel „sprengt ihre eigene Bildlichkeit, wenn sie die innerste Gefühlswelt eines Menschen in einer radikal neuen Sprache ausdrücken soll.“ (S. 200)
Der zweite Teil vorliegender Studie beschäftigt sich mit der zentralen Rolle der Architektur im ersten Roman von Hermann Burger. Die Nähe von Literatur und Architektur ist bei Burger nicht zuletzt durch sein Architekturstudium an der ETH Zürich bedingt. In Burgers Schilten sind wie in Korrektur beschriebene architektonische Konstruktionen und die sprachliche Struktur, mit der sie beschrieben werden, aufs Engste ineinander verschränkt. Der Verfasser führt anhand der Beschreibung des Schulhausdaches vor, dass „die architektonische die narrative Konstruktion bedingt und beschreibt“ (S. 246). Zum einen verweist das architektonische Modell metaphorisch auf den Text, zum anderen werden aber Zweifel an der erkenntnisfördernden Kraft dieses Modells deutlich – es droht, zum illusionären Fetisch zu verkommen. Zimmermanns Analyse von Schilten demonstriert, dass sich die Funktion der Architektur bei Burger komplementär zu der in Korrektur verhält. Während der Kegel die Undarstellbarkeit eines individuellen Innern vorführt, stellt die Architektur des Schulhauses in Schilten eine Oberfläche dar, hinter der sich nichts verbirgt. Dem undurchdringlichen Innen bei Bernhard entspricht ein undurchdringliches Außen bei Burger. Hinter den Masken architektonischer Oberflächen verbergen sich nur weitere Masken. In beiden Fällen bleibt Architektur unlesbar.
Zimmermann versteht Burgers Roman als eine Replik auf Heideggers späten Text Bauen Wohnen Denken. Sieht Heidegger in der Architektur ein Mittel, das wahre Sein zum Vorschein zu bringen, und im Wohnen die Möglichkeit, menschliche Heimatlosigkeit zu überwinden, verbirgt sich in Schilten hinter der Maske der Architektur nur mehr der Tod. An die Stelle von Heideggers Leben im „Geviert“ tritt die Unerträglichkeit eines Lebens im Leerraum zwischen bedeutungslosen Oberflächen, zu dem das an den Friedhof angrenzende Schulhaus mutiert. Der symbolische Verweischarakter von Architektur wird Zimmermann zufolge in Schilten durch ihre Funktion als Allegorie ersetzt. Um den Effekt der Allegorie, symbolische Bedeutungen und semiotische Verweiszusammenhänge aufzulösen, zu betonen, spricht er von einer „Sprengallegorie“ (S. 371).
Ein abschließender historischer Ausblick begreift Bernhards und Burgers Dekonstruktionen des Konzepts einer „sprechenden Architektur“ nicht nur als Antwort auf die Revolutionsarchitektur, sondern auch auf das von Peter Cook 1970 so genannte „Austrian Phenomenon“, nämlich die Architektur-Neoavantgarde um Hans Hollein oder Walter Pichler. Holleins Konzept der „Absoluten Architektur“ negiert eben jene bei Bernhard und Burger klaffende Lücke zwischen Zeichen und bezeichnetem Objekt, sodass der Mythos des allmächtigen architektonischen Subjekts wiederauferstehen kann. Nicht nur dieses, sondern auch das dekonstruktive Projekt eines Derrida oder Bernhard Tschumi, das der Architektur nach dem Ende metaphysischer Endzwecke die Eröffnung neuer Sinnzusammenhänge verspricht, wird von Korrektur wie Schilten zurückgewiesen: „Eine solche Rekonstruktion ist Schildknecht und Roithamer unmöglich, ja sie wird von ihnen gar nicht intendiert, entspringt der Bedeutungsverlust ihrer Architektur doch einem tragischen Scheitern der Lektüreversuche und ist nicht Resultat einer planvollen Dekonstruktion.“ (S. 390)
Zimmermanns Studie schreibt sich in die aktuelle Diskussion über die Frage der Lesbarkeit von Architektur ein. Entgegen einer vorschnellen Analogie zwischen Literatur und Architektur betonen neueste Forschungsarbeiten die Kluft zwischen diesen beiden Medien, die bis in die jüngste Vergangenheit oft durch eine metaphorische Sprache und Argumentation verdeckt wurde. Die Stärke vorliegender Studie liegt darin, dass sie die ästhetische und mediale Differenz von Literatur und Architektur nicht nur aufzeigt, sondern zugleich durch genaue Rekonstruktion (post-)moderner Architekturdiskurse wie (sprach-)philosophischer Kontexte das dichte Netz der Beziehungen zwischen den beiden Künsten sichtbar macht. Besonders Begriffe wie architektonisches Ereignis oder Stimmung erhalten dadurch präzisere Konturen. Terminologisch nicht immer scharf getrennt sind Raum und Architektur, wenn auch aus der Argumentation klar hervorgeht, dass architektonische Räume, anders als natürliche, ihre Entstehung bestimmten Intentionen verdanken und die von Architekten geschaffenen Raumstrukturen menschliche Bedürfnisse befriedigen und menschliches Verhalten steuern wollen. Auf solider epistemologischer Basis aufbauend, verrät Zimmermanns Buch doch eine sympathische und durchaus plausible Inklination zur Literatur: Sie scheint gegenüber der Architekturtheorie einen höheren Reflexionsgrad erreichen und sich vom Trugbild einer stabilisierenden, identitäts- und bedeutungsstiftenden Funktion der Architektur leichter lösen zu können.