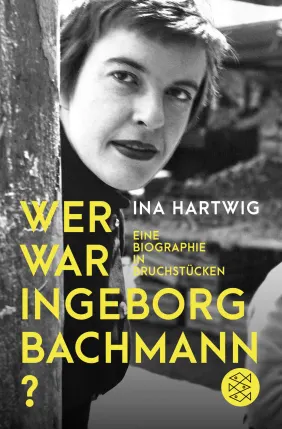In Körperwelt der Politik folgt der Kalte Krieg in Wien, die Wichtigkeit Simone Weils für Bachmanns Politikverständnis, das Treffen mit Henry Kissinger und (im Kapitel: Ein Kritiker) eine Darstellung von Reich-Ranickis Bachmann-Bild. Was nach dem Bruch mit Max Frisch passiert – Krankheit, Ägyptenreise, das Entstehen von Ein Ort für Zufälle, Wüstenbuch, Fall Franza – wird unter dem Titel Berlin, Germany behandelt, denn die Zeit vom April 1963 bis November 1965 verbringt Ingeborg Bachmann in Berlin und dort setzt Ina Hartwig Ingeborg Bachmanns Neubeginn an: »Dass sie hier unglücklich war, verzweifelt, krank, steht fest. […] Dass der Aufenthalt dennoch zu einer Explosion ihrer kreativen Energie führte, ist kaum zu begreifen, aber nicht zu bestreiten: Man könnte das ein Wunder nennen. Das Wunder der Wiedergeburt als Schriftstellerin« (S. 123).
Vielleicht braucht man aber keine Wunder bemühen, es genügt, Bachmann selbst lesen, z. B. ihr Gedicht Prag Jänner 64: »Seit jener Nacht / gehe und spreche ich wieder, / böhmisch klingt es, / als wär ich wieder zuhause, // wo zwischen der Moldau, der Donau / und meinem Kindheitsfluß / alles einen Begriff von mir hat […]«. Was half, war wohl die von Berlin aus unternommene Pragreise. Im folgenden Kapitel (Orgie und Heilung) geht es um Ingeborg Bachmanns Sexualität, das letzte (Guter Vater, böser Vater) ist eine anhand des Romans Malina und der Erzählung Drei Wege zum See durchgeführte, durchaus interessante Analyse von Bachmanns gespaltener Vater-Imago.
Der zweite Teil des Buches besteht aus Gesprächen mit Zeitzeugen – Hans Magnus Enzensberger, Martin Walser, Klaus Reichert, Klaus Wagenbach, Peter Handke, Marianne Frisch, Hans Ulrich Treichel, Christine Koschel und Inge von Weidenbaum, Adolf Opel, Joachim Unseld, Peter Härtling, Renate von Mangoldt, Günter Herburger, Henry Kissinger –, wobei natürlich noch viele andere zitiert werden. Es entsteht also ein sehr informatives Rundumbild nicht nur der unmittelbaren Wirkung, die Ingeborg Bachmann auf ihre Umgebung hatte, sondern auch der nachträglichen Reflexionen ihrer Zeitgenossen.
Einen großen Raum nimmt da, wie auch schon im ersten Teil, Bachmanns sexuelles Verhalten ein, das nach Meinung verschiedener Zeitzeugen der Promiskuität eines männlichen Homosexuellen entsprach. Doch es gibt auch sehr viel Anderes: z. B. Martin Walsers hochinteressante Äußerungen (und das ebenso interessante explizite Schweigen) zu seiner Lektoratstätigkeit an Malina in Rom: Seine Aufgabe hätte darin bestanden, bestimmte Formulierungen »zu verhindern« (!), und das, was »wirklich« dort geschehen ist, könne er »nicht sagen«. Die Bachmann, sei, so Ina Hartwigs Kommentar, »generöser in der Beurteilung der Begegnung. In einem Brief aus Rom an Siegfried Unseld vom 27. 11. 1970 schreibt Bachmann, wie glücklich und dankbar sie über das Treffen mit Martin Walser sei. Sie lobt die konstruktive Arbeitsatmosphäre. Anscheinend haben die Gespräche sie einen guten Schritt weitergebracht« (S. 189 f.). Wer die strategischen Freundlichkeiten der »Wienerinnen« Ingeborg Bachmanns kennt (von Fanny bis zu den Protagonistinnen der Simultan-Erzählungen) wird da etwas skeptisch.
Mehr als interessant ist das Kapitel über Peter Handke. Im Buch Goldmann führt der ältere Malina (alias Ingeborg Bachmann) den jungen österreichischen Schriftsteller Jörg Jonas (alias Peter Handke) durch das indiskrete »Schlachthaus« Frankfurter Buchmesse, in der offensichtlichen Hoffnung, in ihm einen Nachfolger zu finden. Das Verhalten Peter Handkes im Gespräch mit Ina Hartwig – »eine männliche Sphinx, Ingeborg Bachmann ebenbürtig« (S. 199) – zeigt, dass Bachmann den richtigen gewählt hat.
Hoffentlich animiert die Lektüre dieses Buches die LeserInnen dazu, sich danach wieder direkt Bachmanns Texten zuzuwenden. Der berühmte Arzt und Tiefenpsychologe Dr. Hans Strotzka brachte – so erfahren wir dank Adolf Opel und Ina Hartwig – Ingeborg Bachmann bei ihrem ersten und einzigen Zusammentreffen zum Staunen, da er, allein aus der Lektüre ihrer Texte schon eine Diagnose erstellt hatte (S. 236). In ihrem Werk scheint also viel von dem enthalten zu sein, was die LeserInnen, denen es besonders um Bachmanns Person geht, interessieren kann.
Sobald alle privaten Dokumente, Berichte der Zeitgenossen und Briefwechsel Ingeborg Bachmanns veröffentlicht sein werden, wird man aber vielleicht auch entdecken, dass alle diese Dinge historisch sehr interessant sind, dass die Macht Ingeborg Bachmanns aber darin besteht, dass sie, was sie sah und hörte in Geschichten packen konnte, denen man Glauben schenkte und schenkt. Die Beschreibung der politisch und damit auch menschlich kranken Situation im Wien der Nachkriegszeit in der Erzählung Unter Mördern und Irren, die mörderische Arena des Buchmarktes in Das Buch Goldmann (das sie vorerst beiseitelegte, um Suhrkamp das akzeptablere Projekt Malina anzubieten), der geniale Freiheitsentwurf, im Zeichen eines positiven „Zugrundegehens“ des gekränkten Ich in ihrem liebsten und glücklichsten Gedicht Böhmen liegt am Meer, die verwirrten und weisen »Wienerinnen« der Simultan-Erzählungen… – dies sind Geschenke Ingeborg Bachmanns, die für sich stehen.