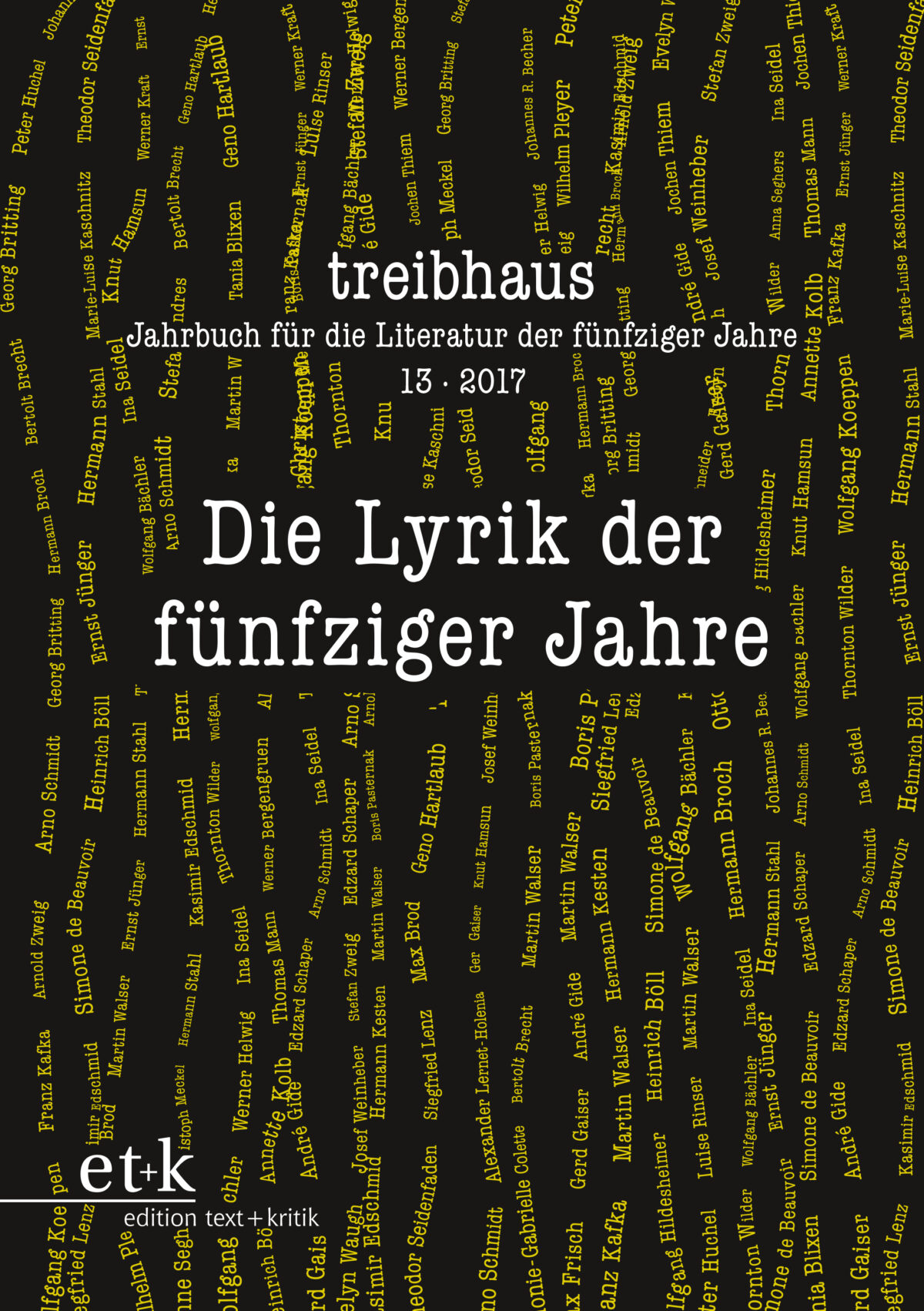Es gibt Kanonisches (Aichinger, Benn, Brecht, Celan), es gibt Vergessene(s), es gibt etwas über Anthologien (Mein Gedicht ist mein Messer, Transit), es gibt Überblicksartikel (Lyrik im Saarland), es gibt Geheimtipps von jetzt und damals (wie den von Robert Menasse dissertationsmäßig behandelten Hermann Schürrer), es gibt Lücken: Die wohl „nach Benn und Brecht“ Bekanntesten, wahre Leitfiguren, nämlich Ingeborg Bachmann und Hans Magnus Enzensberger, scheinen nicht auf, nur das Personenregister weist sie als Bezugsgrößen aus.
Die am häufigsten genannte Forscherin ist dort die Celan-Spezialistin Barbara Wiedemann, die – diesmal quasi gegen den Kanon und weit entfernt von Celan – den Lyriker George Forestier (alias Karl Emerich Krämer) zum Thema macht. In den frühen Fünfzigerjahren von der Kritik unter die ganz großen Lyriker nicht nur des Jahrzehnts gereiht, sondern mit Georg Trakl und Georg Heym verglichen, ist er kaum noch im öffentlichen Bewusstsein präsent. Frau Wiedemann fragt in einer geschickten Analyse nicht (nur) nach dem Autor, sondern vor allem nach dem Publikum dieser „fake lyrics“ einer Abenteuer- und Fremdenlegionärs-Figur, die Projektionen der Kriegs- und Nachkriegsgeneration auf sich zog. Man erinnert sich daran, wie auch Paul Celan dem Zauber der Montur eines Rolf Schroers (aus der frühen Gruppe 47) erlegen ist, bis der „geistige“ Antisemitismus unter der fadenscheinigen Bedeckung sichtbar wurde (so lesbar im Briefwechsel Paul Celans mit seinen rheinischen Freunden, herausgegeben von Barbara Wiedemann).
Auch Hans Egon Holthusen, der sich 1968 bekennerhaft zu seiner Nazi-Vergangenheit äußerte, ist präsent, nicht als Objekt der Untersuchung, aber quasi „zwischen“ jenen Objekten. Der umtriebige Walter Höllerer (mit den Akzenten, mit Transit, mit dem Literarischen Colloquium Berlin, der Theorie der modernen Lyrik etc. ein Erfinder des modernen Literaturbetriebs) wird in Mathias Bernigs Beitrag über die Anthologien kenntlich gemacht, nicht zuletzt mit Hilfe der Polemik Peter Rühmkorfs (dem befremdlicherweise der „Ton, der seinen Beiträgen im Kursbuch der fünfziger Jahre [sic!] entsprach“, vorgehalten wird).
Schon Rühmkorf vermisste im lyrischen Weltbild der Nachkriegsdeutschen eine angemessene Dosis von Wirklichkeits-Zuwendung, von Grass und Enzensberger. An diesen wird zumindest erinnert in dem Text von Michael Braun über Rainer Maria Gerhardt, einem Märtyrer seiner Berufung, einst Hans Magnus Enzensberger an die Seite gestellt und von diesem auch in der verteidigung der wölfe (1957) beklagt, ein suizidales Opfer der Musen, der „neun schönen geliebten, / die deines blutes satt / jubelnd auffahren in ihre unsterbliche wohnung“. Enzensberger ließ sich nicht aussaugen von den Musen, überlebt als „der intellektuell geschmeidigere Typ, der alsbald als erfolgsorientierter Götterliebling loslegte und im Suhrkamp Verlag landete.“
So wenig Komplettheit hier angestrebt und erzielt wird (während ja gerade die großen Anthologien auf solche Komplettheit oder zumindest Repräsentativität aus sind), so nützlich sind die Beiträge, die (natürlich auch qualitativ unterschiedlich) vom konkreten Exempel immer hinausweisen auf die historische Zeit und ihre lyrischen Reflexe und so zumindest die Ahnung von einem Gesamtbild vermitteln.