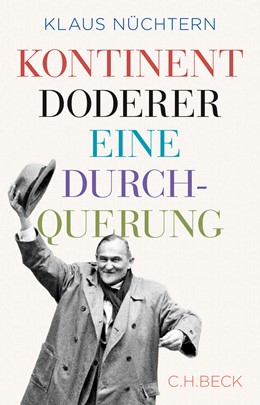Der greifbarste Tiefpunkt dieses Erdteils liegt in einer auf den 1. April 1933 datierten Beitrittserklärung zur NSDAP, seine höchste politische Erhebung in der Ernennung zum österreichischen Kandidaten für den Literaturnobelpreis. Dieser Kontinent neigt zur Unwegsamkeit, den meisten Literaturkundigen sind seine Landschaften bis heute weitgehend fremd, und es gibt hier noch manch exotische Gegend zu entdecken. Das Wandern auf dem Kontinent Doderer, so vielerlei lohnende Ausblicke er auch zu bieten vermag, ist eine Beschäftigung von nur wenigen, oft eher verschrobenen Liebhabern geblieben, von denen sich kaum einer je einen Gesamtüberblick verschafft hat, oder aber von raren Forschungsreisenden, wie sie in mittlerweile dritter oder vierter Generation existieren. Denn eines ist dieser Kontinent erstaunlicherweise nicht: unerforscht. Die Sekundärliteratur ist inzwischen zu durchaus stattlichen Büchermassen angewachsen, das Netz der Untersuchungen ist dicht, weiße Flecken auf der Landkarte sind kaum mehr sichtbar.
Um Forschungslücken geht es dem Wiener Literaturkritiker, „Falter“-Kolumnisten und ausgebildeten Germanisten Klaus Nüchtern auch gar nicht. Er hat zum 50. Todesjahr des Schriftstellers ein Buch mit dem Titel Kontinent Doderer. Eine Durchquerung vorgelegt, das in attraktiver Ausstattung in Doderers Stammverlag C.H.Beck erschienen ist. Der Verlag, dessen Engagement für den 1966 verstorbenen Hausautor als beispielhaft bezeichnet werden kann, zeigt sich in diesem Jubiläumsjahr bemüht und auch durchaus erfolgreich, Doderer vor allem mithilfe des namhaften Kritikers zu erhöhter medialer Aufmerksamkeit zu verhelfen. So kann man neidlos feststellen, dass bislang noch kein Doderer-Forscher es mit seinen Elaboraten zu fast zwei Minuten Sendezeit in der „ZIB 1“ gebracht haben dürfte. Nüchtern räumt, im Kontrast dazu, auf den ersten Seiten des Buches freimütig ein, dass sein Untersuchungsobjekt heute „ganz gewiss ein Minderheitenprogramm“ sei (S. 10), was einerseits bloß einen ohnehin unleugbaren Tatbestand festhält, andererseits aber vielleicht auch auf den wachen Sinn des Publikums für Exklusivität spekuliert. Erklärtes Ziel ist es trotzdem, diese Minderheit quantitativ zu erweitern: „Verpasst man etwas, wenn man Doderer auslässt? Na, keine Frage! Und darauf hinzuweisen ist auch das eigentliche Anliegen dieses Buches.“ (S. 10f.)
Nüchtern bewandert das Doderer-Land in sieben Anläufen, „strikt der eigenen Neugierde“ folgend (so heißt es im Werbetext), mithin also gerade das Gegenteil von strikt, sondern vielmehr ganz unsystematisch, und der Rezensent – selbst Individualreisender – findet das sowohl legitim als auch erquickend. Kapitel 1 unternimmt einen Schnelldurchlauf der Schriftstellerbiographie von dessen beiden Enden her. Kapitel 2 weist auf verblüffende handwerkliche und inhaltliche Parallelen zwischen Doderer und Hitchcock hin, bevor in Kapitel 3 einige Schlaglichter auf Wien als Schauplatz der Romane geworfen werden. Ein Bravourstück ist Nüchtern mit dem vierten Kapitel gelungen, „Von der NSDAP zum Triple-A“, in dem er nach den zeitgeschichtlichen und personellen Hintergründen der erstaunlichen Tatsache fragt, dass Doderer nach dem Zweiten Weltkrieg innerhalb weniger Jahre vom politisch belasteten Autor zum österreichischen Nobelpreiskandidaten avancieren konnte. Nüchtern macht hier vor allem das literarische Netzwerk geltend, in dem sich der Schriftsteller bewegte, und zielt auf dessen raffinierten Umgang mit gewichtigen zeitgenössischen Autoritäten wie einer Hilde Spiel ab, die im Briefverkehr mit dem Schriftsteller, ohne es zu bemerken, schnell zum artig dienenden Mädchen erniedrigt wird. In dieser Plastizität hat man das bisher noch nirgends nachlesen können. Naturgemäß gehörte zu den Bedingungen von Doderers Aufstieg aber auch – und auch hierauf geht Nüchtern ausführlich ein – die politische Großwetterlage der Nachkriegszeit, in der die Aufarbeitung der braunen Vergangenheit schnell von der Frontenbildung des Kalten Krieges überschattet war.
Kapitel 5 behandelt in ähnlich plausibler Weise die problematische Verarbeitung des Justizpalastbrandes in den „Dämonen“ (1956). Hier stellt sich zwar nicht zum ersten Mal, aber vielleicht am drängendsten die Frage, wie gut Nüchtern das Handwerk des Werbetrommlers eigentlich beherrscht respektive wie ernst er sein angebliches Hauptanliegen, auf die Qualitäten des Autors hinzuweisen, wirklich nimmt, wenn es etwa an einer Stelle heißt: „Das ist Doderer at his worst, oder sagen wir: Doderer in einem seiner fragwürdigsten Momente.“ (S. 179) Dem Rezensenten ist das freilich weitaus lieber als jede hagiographische Wahrheitsverbiegung. Nüchtern ergeht sich – zugunsten des Werts seiner Darstellungen – weder in falscher Nachsichtigkeit noch in der Gnadenlosigkeit einer selbstgerechten Nachwelt. Man kommt aber nicht um die Kritik herum, dass das Buch unterm Strich doch anderes bietet, als seine Bewerbung nahelegt. So wäre auch etwa eine Deklaration als Sammlung von sieben Einzelessays (die zusammen kaum eine „Durchquerung“ ergeben) naheliegend und aufschlussreich gewesen und hätte das Buch bzw. dessen Publikum vor möglichen Fehleinschätzungen bewahrt (dem Verfasser wird das freilich nicht anzulasten sein – die Etikettierung bleibt Sache des Verlags). Ob Leser, die Doderer noch nicht kennen, durch dieses Buch wirklich an ihn heranzuführen sein werden, möchte man bezweifeln. Möglicherweise wird der Schriftsteller auch weiterhin ein Minderheitenprogramm bleiben müssen.
Kapitel bzw. Essay 6, dem im Detail erneut einige sehr intelligente Einfälle abzugewinnen sind, befasst sich mit der brutalen Seite von Doderers Werk, den darin enthaltenen Wutausbrüchen, vornehmlich in den „Merowingern“ (1962), und den sich in der Nähe des Terrors bewegenden practical jokes. Und Essay 7 schließlich wendet sich unter verschiedenen Aspekten dem letzten vollendeten Roman, „Die Wasserfälle von Slunj“ (1963), zu, scheint aber seinerseits gleichsam unvollendet geblieben zu sein – man merkt ihm bedauerlicherweise an, dass er unter dem Zeitdruck des drängenden Manuskriptabgabetermins entstanden sein muss. Die eher unzusammenhängende Aneinanderreihung von Beobachtungen zum genannten Roman provoziert im Leser allerdings die spontane Idee, Klaus Nüchtern könnte der ideale Autor für eine zum Beispiel alphabetisch geordnete Sammlung von kleinen Einzelartikeln über das Oeuvre des Schriftstellers sein, eine Idee, die freilich von anderer Seite längst verwirklicht wurde. Mit Henner Löfflers im Jahr 2000 erschienenem „Doderer-Abc“ hat Nüchterns Kontinent Doderer tatsächlich das Ansinnen eines kommentierten Verzeichnisses aller Romanfiguren der „Strudlhofstiege“ und der „Dämonen“ gemeinsam, ein Katalog, der im vorliegenden Fall 52 Seiten füllt. Der Mehrwert dieses Anhangs für den Leser will sich, zumal es auch diesmal nicht ohne kleinere Fehler zugeht, nicht ganz erschließen.
Inhaltlich gibt es am besprochenen Buch sonst kaum etwas zu bekritteln. Klaus Nüchtern ist es gelungen, sich in die Riege der forschenden Kontinentalreisenden einzuordnen, indem er sich nachweislich einen – keineswegs leicht zu gewinnenden – profunden Überblick nicht nur zu Doderers Werk, sondern auch zur einschlägigen Forschungsliteratur verschafft hat. Dass er mit nur wenigen neuen Erkenntnissen aufwartet, kann (große Schätze sind hier nicht mehr zu heben) kaum überraschen. Seine Leistung besteht vor allem darin, Ergebnisse, die die Forschung produziert, aber kaum je einem größeren Publikum vermittelt hat, neu zu kombinieren und in über weite Strecken vergnüglich zu lesende Essays zu gießen, die stilistisch oft glänzen und sich darüber hinaus manch erfrischende handwerkliche Freiheit erlauben, welche sich der reinen Wissenschaft verbieten würde. Dass das Buch mit einem durchaus üppigen Fußnotenapparat auffährt, gehört zu seinen äußerlichen Fehlsignalen, ist aber vor allem der Seriosität geschuldet, bewahrt es den Autor doch vor dem möglichen Verdacht, sich mit fremden Federn schmücken zu wollen. Es wäre zynisch, gerade als Germanist den Vorwurf auszusprechen, dass die Fußnoten die Lektüre mitunter merklich erschweren. Manche Fußnote lässt freilich erkennen, dass auch der Journalist, hat er sich auf die wissenschaftliche Methodik einmal eingelassen, vor der Lust an pedantischen Auswälzungen in einem wuchernden Apparat nicht gefeit ist – den Fachwissenschaftler befällt da eine diebische Freude.