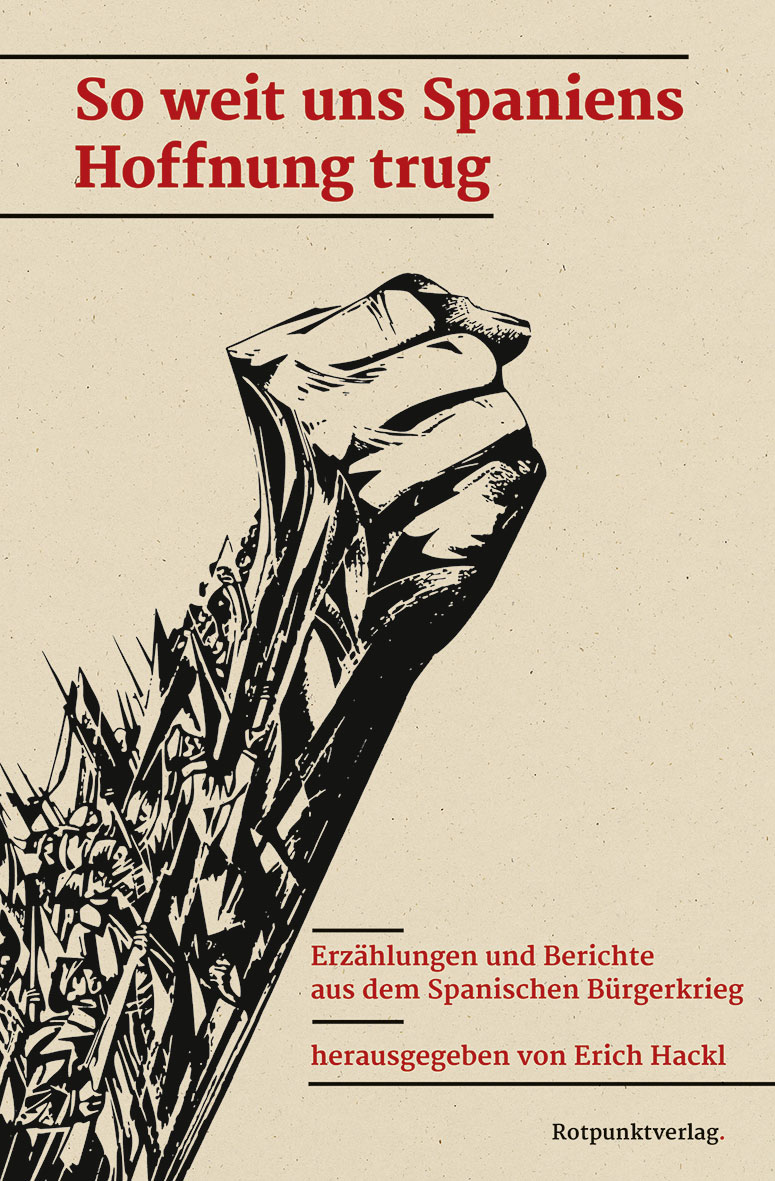Die hier vorliegende Anthologie So weit uns Spaniens Hoffnung trug erscheint zum 80. Jahrestag des Putsches der Franco-Generäle vom Juli 1936 gegen die damals noch junge, erst 1931 ausgerufene spanische Republik – auch die Gründung der ab Oktober 1936 aufgestellten Internationalen Brigaden jährt sich 2016 zum achtzigsten Mal. Beide Jahrestage wurden auch außerhalb Spaniens in der Öffentlichkeit durchaus wahrgenommen, allerdings wohl doch beschränkt auf linke Kreise.
Der Band widmet sich allein der deutschsprachigen Literatur, umfasst dabei aber doch, wie der Untertitel ausweist, sechs Länder, es sind deutsche, Deutschschweizer und österreichische Autoren und Autorinnen sowie solche, die in österreichischen Kronländern geboren wurden oder auch auf französische oder katalanisch publizierten. Ein weiteres Auswahlkriterium ist die Zeitgenossenschaft der hier vertretenen Schreibenden, sie alle waren vor Ort und praktisch engagiert – als Kämpfende, im Sanitätsdienst oder in welchen Funktionen auch immer. Allerdings werden in der Sammlung nicht nur Texte, die während des Bürgerkrieges entstanden sind, aufgenommen, sondern auch später verfasste bzw. veröffentlichte Werke. Das macht den Band ein wenig heterogen, stehen doch Texte aus dem unmittelbaren Geschehen selbst neben solchen aus der Nachbetrachtung. Die Anthologie folgt also nicht dem historischen Prinzip ‚aus der Zeit über die Zeit“, sondern ist zeitübergreifend organisiert und will thematisch die unterschiedlichsten Facetten des Krieges dokumentieren. Dazu dienen neben abgeschlossenen Erzählungen, Berichten und Skizzen auch Auszüge aus Romanen oder Autobiographien. Die Lyrik bleibt wie das Theater und die politische Essayistik ausgeblendet.
So entsteht ein Lesebuch mit den einschlägigen großen Namen, etwa Carl Einstein, Hermann Kesten, Egon Erwin Kisch, Arthur Koestler, Erika Mann, Joseph Roth, Anna Seghers, Ernst Toller. Vertreten sind zudem ‚Klassiker“ der Spanienliteratur wie Willi Bredel, Eduard Claudius, Alfred Kantorowicz, Rudolf Leonhard, Karl Otten, Gustav Regler, Ludwig Renn und Bodo Uhse. Besonders hervorzuheben ist aber, dass eben nicht allein die Prominenz der deutschsprachigen Spanienliteratur vertreten ist, sondern auch die unbekannteren oder heutzutage ganz unbekannten Autoren, darunter nicht wenige – neun an der Zahl – Autorinnen, die hier der Vergessenheit entrissen werden und deren Engagement eine angemessene Würdigung erfährt. Da gibt es einiges zu entdecken oder wieder zu lesen.
Unter den Autorinnen sind neben Erika Mann und Anna Seghers die Journalistinnen und Erzählerinnen Maria Osten, die, ein Opfer des Stalinismus, 1942 hingerichtet wurde, und Ruth Rewald, die, ebenfalls im Jahr 1942, in Ausschwitz ermordet wurde, hervorzuheben, aber auch Anna Siemsen, eine der Wenigen aus dem sozialdemokratischen Spektrum – das Gros der Autorinnen und Autoren ist ja politisch links der Sozialdemokratie anzusiedeln. Zu erwähnen bleiben noch die ganz unbekannte 1907 in Wien geborene Lisa Gavri?, die ebenso wie die aus Czernowitz stammende Gusti Stridsberg als Krankenschwester arbeitete und darüber berichtete, oder die Schweizerin Clara Thalmann, die zusammen mit ihrem Mann Paul auf Seiten der als trotzkistisch denunzierten und von den Parteikommunisten verfolgte POUM kämpfte.
Damit ist ein weiterer Aspekt der Anthologie angesprochen. Unter den sieben Kapiteln des Bandes findet sich eines, überschrieben „Der Krieg im Krieg“, das sich explizit den selbstzerstörerischen Kämpfen innerhalb der Antifaschisten widmet, also den Auseinandersetzungen zwischen Anarchisten und anderen linksradikalen Kräften auf der einen und den Kommunisten und Stalinisten auf der anderen Seite, der sich in den Ereignissen vom Mai 1937 in Barcelona bis hin zur militärischen Konfrontation zwischen den Gruppierungen zuspitzte. Es ist ja eine bis heute nicht ausdiskutierte Frage, inwieweit es sinnvoll oder erfolgreich scheinen konnte, die soziale Revolution unmittelbar mit dem Abwehrkampf gegen den Faschismus zu verbinden – so, wie es die gerade in Barcelona und in ganz Katalonien sehr starken Anarchisten und die sog. Trotzkisten versuchten bzw. anstrebten. Die scharfe Gegenposition vertraten die von Moskau und der Komintern unterstützten Kommunisten, die den antifaschistischen Kampf allein durch eine Politik der Volksfront unter Einschluss bürgerlicher Kräfte und dementsprechend unter Verzicht auf sozialrevolutionäre Maßnahmen zu führen suchten. „Ganz Spanien ist ja von der Diskussion ‚Demokratie oder Sozialismus“ durchströmt“, schreibt dazu der deutsche Avantgardist Carl Einstein, der selbst in der anarchistischen Kolonne Durruti kämpfte und der noch 1937 prognostizierte: „Der Faschismus kann in Spanien nicht verwirklicht werden. Hitler und Mussolini verlieren diesen Krieg.“ (S. 79)
Der Bruderkrieg innerhalb des Bürgerkrieges, bei dem die Anarchisten zunehmend unter kommunistischen Druck und in die Defensive gerieten, bis hin zu Verfolgung und Liquidierung, ohne dass aber die Kommunisten reüssiert hätten, markiert wohl das tragischste Kapitel im gesamten Spanienkrieg. Ihm wie gesagt widmet der Band drei anarchistisch gefärbte Beiträge (von Edwin Gmür, Clara und Paul Thalmann sowie von Augustin Souchy), hier hätte man sich weitere Texte gewünscht.
Die insgesamt sieben Kapitel gewährleisten einen ungemein facettenreichen Blick ins Geschehen – beginnend mit „Klang der Revolution“ über „Unter schwerem Feuer“ bis zu „Angst und Heldentum“ und am Ende: „Die Frage nach der Vergeblichkeit“. Es geht um die neue (oder auch alte) Rolle der Frau (Ruth Rewald u.a.) und um die Frage, was der Krieg mit den Kämpfern macht, um den Luftkrieg, um die Kämpfe auf Mallorca (Karl Otten und Albert Vigoleis Thelen), um die Bombardierung von Guernica durch Flugzeuge der Legion Condor (Hermann Kesten). Viele Motive und einzelne Aspekte des Krieges durchziehen einhellig diese Aufzeichnungen, so Wut und Verzweiflung über das Versagen der westlichen Demokratien, allen voran Frankreich und England, die sich hinter einer Nichteinmischungs-Politik verschanzten und damit dem Faschismus zuarbeiteten. Oder die Intervention deutscher und italienischer Truppen – brillant zur Sprache gebracht u.a. in einem kaum zweiseitigen Feuilleton von Joseph Roth, „An der spanischen Grenze“, in dem es nach dem Fall von Barcelona anspielungsreich um ein „Hotel Italien“ geht, das mit „tout comfort“ wirbt – „Sie könnten sich auch ‚Hotel Allemand“ nennen“ (S. 350f.). Es sind also Texte, die mit den Worten von Maria Osten eines wollen: daß der Leser „alles wie am eigenen Leibe verspürt, daß er es miterlebt, nicht schlafen kann, bevor er es dem andern nicht mitgeteilt hat und mit dem andern nicht bereit ist, zu helfen.“ (S. 106)
Einen weiteren Themenbereich bilden die Interbrigadisten und die internationale Solidarität, beeindruckend z.B. jene Liste von immer nur knapp charakterisierten Kämpfern bei Hanns-Erich Kaminski, wo es lakonisch heißt: „Der Revolution wegen sind sie, einige zu Fuß, aus allen Ländern Europas gekommen und sogar von anderen Kontinenten.“ (S. 54) Als Pendant dazu ließe sich jene beeindruckende Liste lesen, die ebenso lakonisch die bereits erwähnte Lisa Gavri? präsentiert: Es ist eine Internationale der Verwundeten, wahrlich eine des Schreckens (S. 277-285).
So bieten das Ensemble der hier vorgelegten Prosatexte ein ungemein dichtes und komplexes, ebenso informatives wie gut lesbares Stück Geschichte. Dabei ließe sich über die Auswahl trefflich streiten – darum soll es hier nicht gehen. Jedenfalls ist der Herausgeber, der österreichische Schriftsteller Erich Hackl für diese Edition bestens ausgewiesen, hat er doch bereits 1986 eine ähnliche Anthologie vorgelegt („Geschichten aus der Geschichte des Spanischen Bürgerkrieges“, Sammlung Luchterhand) und zusammen mit dem 2014 verstorbenen Spanienkämpfer Hans Landauer das verdienstvolle „Lexikon der österreichischen Spanienkämpfer 1936-1939“ herausgegeben (Wien 2008).
Beim letzten Beitrag dieser Anthologie handelt sich um flüchtige Notizen von Ernst Toller, der spät, Ende Juli 1939, in Spanien ankam, also zu einer Zeit, da die Sache der Republikaner längst verloren war. Er überschrieb seine Aufzeichnungen illusionslos mit „Stichworte eines Scheiterns“. Die letzte Zeile lautet. „Traum und Wirklichkeit“. Über Beides, die Hoffnung wie die Realität, die Utopie wie die Miserabilität der Verhältnisse, ist in diesem wichtigen Spanien-Buch nachzulesen.