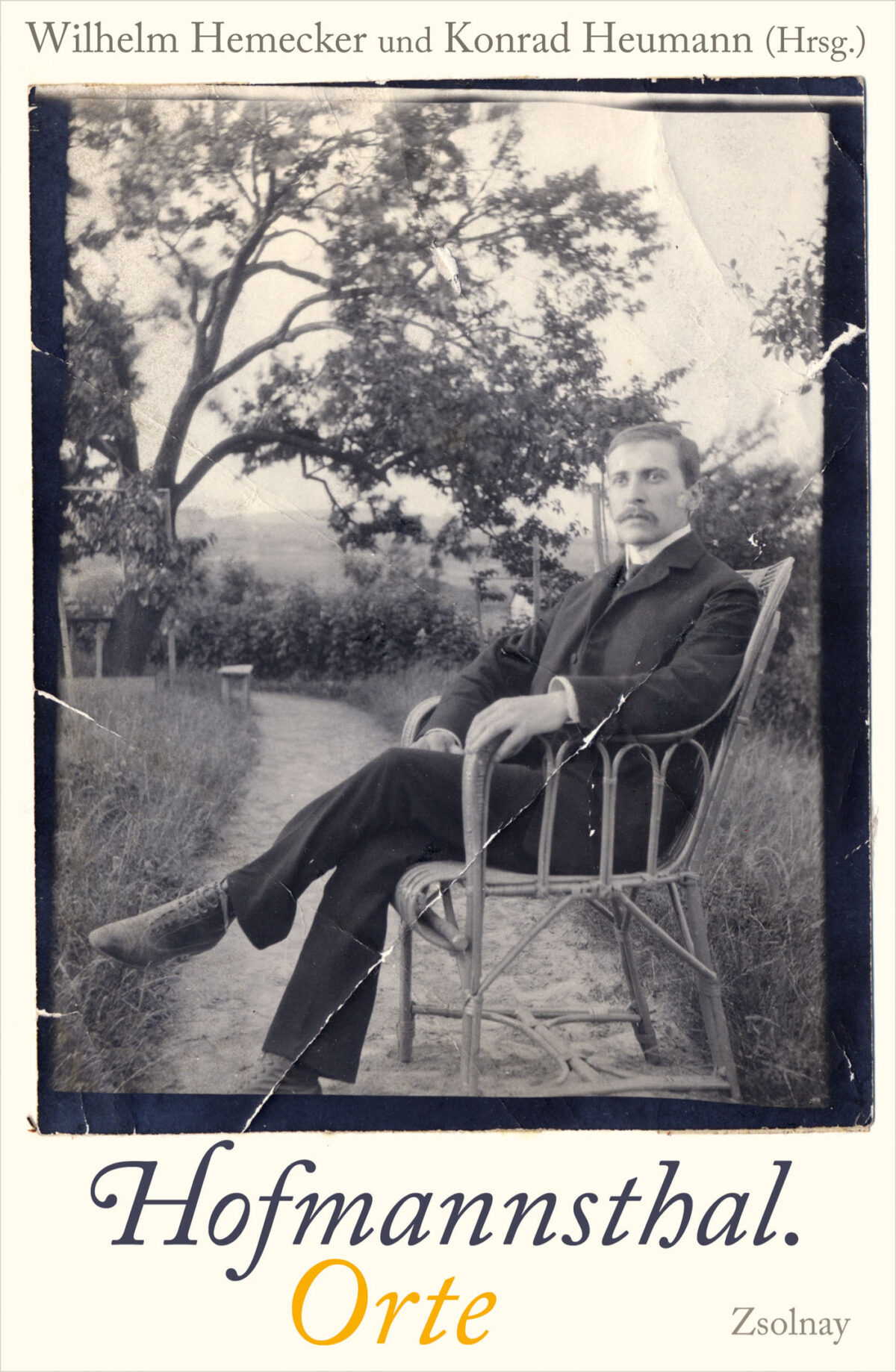Wie auch immer: Die Formel „in Zusammenarbeit mit“ zieht eine seltsame Hierarchisierungsebene ein und verunmöglicht der Wissenschaftlerin den Eintrag in ihre Publikationsliste; leider muss man solches „Zuarbeiten“ – etwa von ProjektmitarbeiterInnen an Universitäten – immer noch beobachten. Im 21. Jahrhundert, in dem auch in den Geistes- und Kulturwissenschaften Teamarbeit immer essentieller wird, ist eine solche unsolidarische, hierarchisierende Praxis aus der Ära des steinzeitlichen Lehrstuhlpatriarchats völlig unzeitgemäß.
Zu den Paratexten zählen auch Umschlagrückseiten: Dort ist von „bisher weitgehend unbekanntem Archivmaterial“ zu lesen, auf den sich der „reich illustrierte Band“ stütze. Leider wird dann im Buchinneren nicht mehr ausgeführt, was es mit dem „unbekannten Archivmaterial“ auf sich hat. Und zu den Paratexten gehören Vorwörter. Hofmannsthal. Orte begnügt sich mit einer zweieinhalbseitigen „Vorbemerkung“. Wahrscheinlich wollte man das Buch in einem Publikumsverlag mit keiner akademischen Fracht beladen, aber so zurückhaltend, dass man nur von einem „Begleiter“ an zwanzig Orte der Biographie spricht, hätte man nicht sein müssen. Die Herausgeber bleiben sehr allgemein, sprechen von „lebensgeschichtlichen Prägungen“ durch die aufgesuchten Orte, sie bieten keinerlei Überlegungen aus biographietheoretischer Sicht, keine tiefere Reflexion darüber, was es heißt, Raumkonstellationen für die Biographik fruchtbar zu machen, oder darüber, auf welche Raumkonzepte (etwa ,Erinnerungsräume‘) die Beiträge zurückgreifen.
Damit aber genug der Paratexte. Zumal der Haupttext mit seinen 20 Schlaglichtern auf zentrale Orte der Hofmannsthal-Biographie durchwegs erhellende, instruktive und auch für den Nicht-Experten bestens verständliche Einblicke in die Welt des Dichters gewährt. Den Beginn macht Mitherausgeber Heumann mit seinen Ausführungen zum elterlichen Haus in der Wiener Salesianergasse (die Stationen sind klassisch-chronologisch angeordnet). Heumann postuliert hier ein räumlich dialektisches Prinzip der beiden Sphären des Exterieurs und Interieurs, das er in Korrespondenz setzt zum Außen- und Innenleben des Aufwachsenden. In dieser Zeit habe sich Hofmannsthal, so Heumann, eingeübt in die für ihn spezifische Beobachtung und Umformung seiner Umgebung, eingeübt in die Eigenart, „die Dinge und die Verhältnisse nicht so hinzunehmen, wie sie zunächst erscheinen“, es gehe beim Beobachten (wie beim Dichten), draußen und im Häuslichen, um die Verwandlung der Welt. Im Draußen ortet Heumann in der Architektur der näheren Umgebung, in dem „spätbiedermeierlichen Ensemble von geradezu programmatischer Geschlossenheit“ ein Insignum der Entindividualisierung. Gemeinsam mit den Menschen, die die Gasse tagsüber bevölkern – allesamt „keine stationären Existenzen“ (Heumann) – und dem Gegenpol der behüteten Häuslichkeit der Wohnung sind das prägende Eindrücke für den Aufwachsenden.
Bei Tobias Heinrich und seinem Beitrag über das Akademische Gymnasium kann man lernen, dass das Gebäude der erste neugotische Profanbau Wiens war, dass Latein vor 1848 über die Hälfte der Unterrichtszeit in Anspruch nahm, zu Hofmannsthals Gymnasialzeit immerhin noch ein Viertel; zur Zusammensetzung der Schüler erfährt man, das hier rund die Hälfte Juden und nur ein geringer Teil adelig waren. Heinrich beschränkt sich auf Hofmannsthals Ennui während seiner Schulzeit – um sich nicht zu langweilen, erweiterte er privat die Schulfächer um zahlreiche Studien und Lektüren –, der aufgehende, hell leuchtende Stern des Schüler-Dichters „Loris“ wurde andernorts ausreichend abgehandelt.
Zu den schönsten Beiträgen des Bandes zählt jener über Bad Fusch, jenen heute verfallenen kleinen Kurort inmitten der Salzburger Hohen Tauern, den Hofmannsthal zu all seinen „Wendejahren“, den Vollendungen seiner Dezennien, insgesamt aber erstaunliche 14 Mal aufsuchte. Joachim Seng schafft hier eine konzise Verknüpfung von Biographie und Ort (die kleinen Unsicherheiten bei der Benennung der topografischen Gegebenheiten werden wohl nur die Pinzgauer unter den LeserInnen bemerken); und er schreibt zudem en passant eine kleine Studie zu dem ergiebigen Thema „Hofmannsthal und das Wasser“. Das „feuchte kühle Tal“ sei voll mit seiner „Gestalt“, schreibt der Autor einmal in einem Brief, er begegnet hier immer auch dem jüngeren Selbst – und es ist vor allem das „besondere Wasser“, das es ihm hier angetan hat. Denn Bad Fusch ist alles andere denn ein bequemer, ansehnlicher oder gar schicker Kurort, mit weiter Anreise, nur aus zwei Gasthäusern bestehend, ein „Nest“, hässlich, aber ein „sonderbar wohltuender Aufenthalt“, wo man „unter dem ersten Anhauch der Luft“ gesund werden könne, wo einen das „kräftige helle Wasser“ erfreue.
Hofmannsthal. Orte macht klar, dass es dem sensiblen, vielleicht auch ein wenig hypochondrischen Dichter nicht um Bequemlichkeit zu tun war bei der Wahl seiner Arbeitsorte. Das Haus in Rodaun war zwar ein kleiner Adelssitz, aber das alte Haus ließ sich etwa für die zu Beginn des 20. Jahrhunderts aufkommenden sanitären Bequemlichkeiten kaum adaptieren. In Bad Fusch waren die beiden Unterkünfte ohnehin „halb Schweizerhôtel, halb Ziegenstall“, wie der 19-Jährige schrieb, in der anderen Hofmannsthal’schen Sommerfrische, Obertressen über Altaussee, gab es nur ein einfaches, kleines Holzhaus. Es ging ihm um die richtige Temperatur, Stimmung, Atmosphäre, und um Ruhe und Abgeschiedenheit. Das war ja der Hauptgrund, warum er sich nach der Hochzeit nicht im Stadtzentrum Wiens, sondern in einem Vorort niederließ. Hofmannsthal. Orte macht aber auch klar, dass der Autor genauso den Trubel schätzte und brauchte und immer wieder aus der Rodauner Abgeschiedenheit floh, etwa in die Metropolen Berlin, München oder Prag, gerne nach Venedig, öfters nach Dresden, dem wichtigen Aufführungsort der Gemeinschaftsarbeiten mit Richard Strauss.
In Wien gerinnen die angeführten Orte im Idealfall zu Sinnbildern zentraler biographischer Konstellationen, in Katya Krylovas Beitrag über die Wiener Universität etwa werden die linke und rechte Stiege, die Philosophen- und Juristenstiege, zu Metaphern für die beiden möglichen Karrierewege Hofmannsthals; das Burgtheater wird zum Sinnbild des dritten Wegs, der Schriftstellerkarriere; und im Prater führt David Österle vor, wie schwer Hofmannsthal die ,Leichtigkeit‘ des Daseins fiel und mit welchen Vorbehalten er dem „Pöbel“, dem Proletariat begegnete – über den „Sozialraum“ Prater und Hofmannsthals Verortung darin hätte man gerne mehr und Genaueres gelesen (aber das Buch hat auch so schon 500 Seiten). Das gilt auch für das anderswo erwähnte Detail, dass Hofmannsthal 1906 die Möglichkeit hatte, die berühmte Palladio-Villa La Rotonda bei Vicenza zu kaufen.
Warum im Abschnitt über Rodaun zwar das dem „Hofmannsthal-Schlössl“ benachbarte Gasthaus Stelzer erwähnt wird, nicht aber der Umstand, dass sich hier während des Ersten Weltkriegs das Kriegspressequartier befand, bleibt erstaunlich, war doch Hofmannsthal in ähnlicher Funktion tätig – bei der „Pressegruppe des k.u.k. Kriegsfürsorgeamtes“ (wie man im Abschnitt zu Prag erfährt). Vielleicht wollte man sich die Öffnung der Karl-Kraus-Flanke ersparen („Man hat die Presse nach Rodaun verlegt, um dem Herrn v. Hofmannsthal mit der Front entgegenzukommen“). Katja Kaluga und Katharina Schneider beschreiben hier jedenfalls detailgenau die Inneneinrichtung des Hauses, bei der Hofmannsthal die Stilreinheit des Historismus aufhebt, also ganz bewusst einen individuellen Stil pflegte. Womit der Bogen zu Konrad Heumanns Beitrag gespannt ist, der ja eine starke Entindividualisierung in der Salesianergasse ausmachte.
An einzelnen Stellen sind die AutorInnen etwas zu nahe an ihrem Untersuchungsgegenstand und seiner Diktion: Als er 1901 nach Rodaun übersiedelte, sei er „in eine ganze Welt“ gezogen; und die Festspielstadt Salzburg befinde sich im „katholisch-süddeutschen Raum“; außerdem werden Passagen auf Französisch nicht übersetzt, so als ob der Hofmannsthal-Leser, wie der Meister selbst, die Sprache selbstverständlich fließend beherrsche.
Solche Kleinigkeiten und die Paratexte tun aber dem Gesamteindruck keinen Abbruch: eine schöne Hofmannsthal-Landkarte!