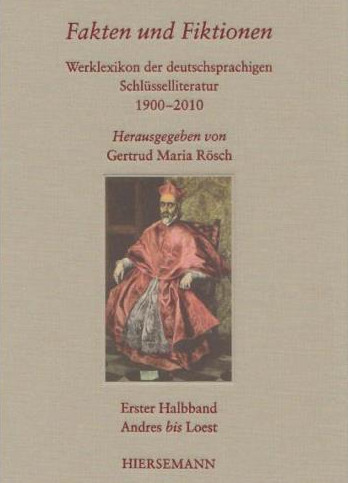Dass Manns Roman in der deutschsprachigen Literatur des 20. Jahrhunderts mitnichten allein dasteht, zeigen die zwei von Gertrud Maria Rösch herausgegebenen und prachtvoll vom Hiersemann-Verlag edierten Bände Fakten und Fiktionen, ein fast 800 Seiten starkes Werklexikon der deutschsprachigen Schlüsselliteratur, das Romane erfasst, die zwischen 1900 und 2010 erschienen sind. In 133 ausführlichen Artikeln, alphabetisch nach Autoren und Autorinnen geordnet, werden hier rund 200 Werke nacherzählt und analysiert.
Der Begriff geht zurück auf das zweibändige Les livres â clef (1888) von Fernand Drujon. In Deutschland wurde die Gattung erstmals von Georg Schneider eingehend bearbeitet, dessen dreibändiges Werk Die Schlüsselliteratur. Entschlüsselung deutscher Romane und Dramen zwischen 1951 und 1953 erschien und auf etwas mehr als 600 Seiten Schlüsselwerke seit der Klassik bis in die Gegenwart des Autors umfasst. Eine philologische Meisterleistung, die nun von diesem Lexikon fortgesetzt wird, an dem neben der Herausgeberin 61 Spezialisten mitgewirkt haben. Röschs Lexikon versteht sich als Fortführung von Schneiders Pionierarbeit, denn zu vier eigenen Registern (Personen-, Werk-, Sach- und Ortsregister) nimmt es das Register des zweiten Bandes von Schneiders Werk auf, der der „Entschlüsselung deutscher Romane und Dramen“ gewidmet ist, und erweitert so die eigene Perspektive zurück bis ins 17. Jahrhundert.
Gertrud Maria Rösch, die Herausgeberin, lehrt Literaturwissenschaft an der Universität Heidelberg und hat bereits einiges zum Thema publiziert, so etwa ihre Habilitation Clavis scientiae (2004) oder den Sammelband Codes, Geheimtext und Verschlüsselung (2005). In ihrem Vorwort umreißt sie kurz die Geschichte der Untergattung und definiert sie neu mithilfe des „Prinzips Schlüssel“ (S. X), der die bloße Gattungsbezeichnung ausweitet zu einem Erzählverfahren, das auf der Zusammenarbeit beruht zwischen Autor, der verschlüsselt, und Rezipient, der entschlüsselt. Das Konzept wird dadurch dynamisiert, da es den Erfahrungshorizont des Lesers, der Leserin ins Spiel bringt, von dem es schlussendlich abhängt, was an dem jeweiligen Werk entschlüsselt wird – wodurch zugleich kulturellen, historischen und zeitlichen Aspekten eine Bedeutung zukommt, die sie bislang nicht hatten. Zudem wird der erzählerische Kunstgriff auf andere Werke anwendbar, die an sich nicht in diese Untergattung zu zählen sind.
Dem Ausdruck „Schlüsselliteratur“ haftet bis heute ein Beiklang an, der sich zwischen den Extremen von Schlüssellochperspektive und Literatur mit politischen Wirkungsabsichten in schwierigen Zeiten bewegt. Dass die zweite Variante weitaus überwiegt, belegt dieses Lexikon überzeugend. Zwar gibt es eine Gruppe von Romanen, die Themen aus dem „Privatleben“ oder aus dem „Künstlermilieu“ zum Inhalt haben, die meisten hier behandelten Romane und Erzähltexte haben aber politische und soziale Inhalte, sind in den Klassenkämpfen der Weimarer Republik, im Exil, im Dritten Reich, in der „inneren Emigration“ angesiedelt, aber auch im Nachkriegsdeutschland, wo sie sowohl die BRD (von Böll bis Manfred Zachs Monrepos) als auch die DDR (bei Hermann Kant oder Stefan Heym, vom dem ganze acht Bücher analysiert werden) unter erfundenem Namen porträtieren, und schließlich auch in Österreich (Menasse, Rosei und Schindel etwa) und in der Schweiz (Frisch, Glauser, Hürlimann, Widmer).
Zugleich sind die beiden Bände ein Querschnitt durch die Literatur des 20. Jahrhunderts. Bekannte Schriftsteller wie Grass, Lenz, Koeppen, Seghers, Johnson, Hein, Schnitzler, Musil, Canetti, Bachmann, Jelinek, Bernhard, Handke, Christa Wolf, Thomas, Heinrich und Klaus Mann, Joseph Roth, Herta Müller stehen neben eher unbekannten Autoren und Werken wie Otto Julius Bierbaums Prinz Kuckuck (1906-1907), Heinz Dieckmanns Narrenschaukel (1984), Karl Grünbergs Brennende Ruhr (1929) oder Romanen von Franziska zu Reventlow. W. G. Sebalds vielzitierte postmemorialistische Texte werden ebenso analysiert wie Uwe Tellkamps Der Turm und befinden sich in Nachbarschaft zu weniger namhaften Werken wie Milo Dors Paul-Celan-Roman Internationale Zone (1953) oder Walter Gronds steirischer Kulturszenenpersiflage Der Soldat und die Schöne (1998). Halb oder ganz vergessene Texte von Ulrich Becher, Ernst Glaeser, Gustav Regler, Bruno Apitz, Nicolas Born, Günther Weisenborn, Erik Reger, René Schickele, Fritz Wittels und anderen mehr werden in Erinnerung gerufen, und man kann als Leser nur dankbar für die vielen Anregungen sein.
Seltsamerweise kommen wenige Frauen vor, nicht mehr als fünfzehn. Neben den bereits genannten Autorinnen werden Claire Golls Arsenik (1927), Die Schwestern Kleh (1933) von Gina Kaus, drei Romane von Anette Kolb und Käsebier erobert den Kurfürstendamm (1931) von Gabriele Tergit besprochen sowie Werke von Gegenwartsautorinnen wie Thea Dorn, Jenny Erpenbeck, Katja Lange-Müller und Cornelia Schleime.
Grundsätzlich kann man bedauern, dass – im Gegensatz zu Georg Schneiders Werk – dramatische Texte nicht aufgenommen wurden – und vor allem über die Begründung ihres Ausschlusses debattieren. Ihre Wirkung beruhe nämlich „im Wesentlichen auf der theatralischen Aufführung“ und sei „schwieriger zu rekonstruieren und zu beschreiben […] als die Wirkung eines Erzähltextes“ (S. XV). Dabei scheint es vielmehr, als sei die deutschsprachige Dramatik des 20. Jahrhunderts andere Wege gegangen als die Prosa und ließe sich nicht so leicht in die für diese geltenden Kategorien der Verschlüsselung einschreiben – man denke nur an die Realität und fiktionale Verbrämung ganz anders durcheinander werfenden Dramen von Kraus, Bernhard, Jelinek, Tabori, Weiss, Hochhuth und vielen anderen. Wünschenswert wäre hier ein dritter, den deutschsprachigen Dramen gewidmeter Band, um dieses Thema theoretisch und praktisch zu erweitern und zugleich abzurunden.
Ebenso kann man über die Auswahl diskutieren, und jede Leserin, jeder Leser hätte wohl punktuell andere Autorinnen, Autoren und Bücher aufgenommen und einige, die hier vorkommen, weggelassen. So etwa kommt zwar Soma Morgensterns Die Blutsäule vor, nicht aber sein „Romanbericht“ Flucht in Frankreich (der dafür im Eintrag zu Walter Hasenclevers Die Rechtlosen gewürdigt wird). Marcel Beyers Kaltenburg wird besprochen, nicht aber Flughunde. Bei Gustav Regler fehlt Der große Kreuzzug. Ebenso scheint fraglich, ob es tatsächlich notwendig war, Thomas Brussigs Am kürzeren Ende der Sonnenallee zu besprechen, denn das Ergebnis ist denkbar dürftig, kommen doch, sieht man von dem Mann mit dem „Muttermal auf der Stirn“ ab, keine weiteren historischen oder anderswie bedeutenden Persönlichkeiten vor.
Solche Divergenzen gehören aber zu den Wesensarten von Lexika, die aufgrund der Fülle an Material ohnehin nicht den Anspruch auf Vollständigkeit stellen können und wollen. Und sie sollen vor allem nicht darüber hinwegsehen lassen, dass dieses Lexikon der Schlüsselliteratur nicht nur ein originelles, sondern auch ein äußerst anregendes Buch ist, das auf Werke aufmerksam macht, sie aus dem Vergessen holt oder sie vorstellt, die in ihrer seltsamen Mischung aus Realität und Fiktion eine besondere Art der Geschichtsschreibung des 20. Jahrhunderts darstellen, die, jedes auf seine Art, den Umgang mit der Realität hinterfragen, den Zugang zu ihr und die dünne Schwelle, die das „Wirkliche“ vom „Erfundenen“ trennt oder zu trennen scheint.