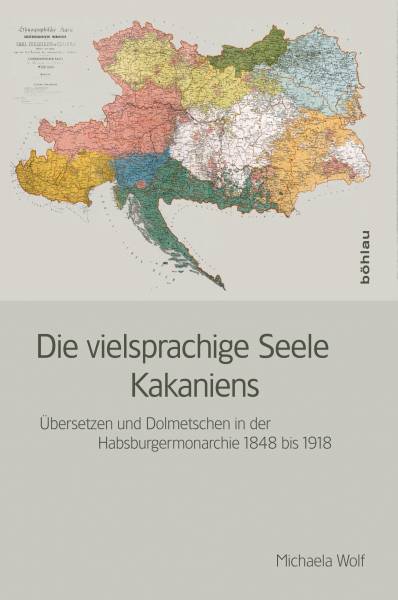Ein Unternehmen, das so weitläufig ist wie das polykulturelle, plurizentrische und vielsprachige Reich mit seinen 51 Millionen Menschen groß war, das aber gelingt dank der interdisziplinären Vorgangsweise Wolfs, die historische, linguistische, literarhistorische und soziologische Ansätze mit translationswissenschaftlichen verknüpft. Im Hintergrund stehen dabei die geschickt assimilierten Erkenntnisse der postkolonialen Theorien, vor allem aber die Soziologie Pierre Bourdieus, die Wolf in Form der „Translationssoziologie“ zum Hauptanalyseelement ihrer Arbeit macht.
Die Autorin geht von der These aus, dass „das Phänomen der Übersetzung“ nicht nur als Mittel der Verständigung zwischen den verschiedenen Kulturen der Habsburgermonarchie und als Medium eines kulturellen Transfers mit anderen Kulturen jenseits der Grenzen des K.u.k.-Reichs diente, sondern dass es in seinen vielfältigen Formen „in hohem Maß zur Konstruktion der Kulturen des habsburgischen Raums“ (S. 15) beitrug. In einem ersten Schritt erläutert Wolf ihr Konzept von Translation. Den Prozess des Übersetzens teilt sie in zwei Ebenen: in eine strukturelle Ebene, auf der Elemente wie Herrschaft, Macht, ökonomische, soziale, politische Interessen angesiedelt sind, und in eine Ebene der im Translationsprozess involvierten Personen, wobei es naturgemäß zu einem unausgesetzten Wechselspiel zwischen beiden Ebenen kommt. Anschließend legt sie eine ausgefeilte Theorie des translatorischen Handelns vor, in deren Verlauf die wichtigsten kulturwissenschaftlichen Erkenntnisse der letzten drei Jahrzehnte diskutiert werden. Wolf stützt sich auf die von Moritz Csáky entwickelte These der „endogenen“ und „exogenen“ Pluralität der zentraleuropäischen Region, wobei sich der erste Begriff auf die innere kulturelle Vielfalt bezieht, der zweite auf all jene Elemente, die von außen kamen und zu einer kulturellen Erweiterung der Region führten. Daran anschließend unterscheidet Wolf zwischen zwei grundsätzlichen Formen der Übersetzung: einer „polykulturellen Kommunikation und Translation“, also alle „Translationsformen zwischen den Sprachen der Monarchie“ (58), von literarischen Übersetzungen und Gesetzestexten bis hin zu professionellen „Translatoren“ (also Dolmetscherinnen und Übersetzern), und einer „transkulturellen Translation“, die all jene Übersetzungen im weitesten Sinn betrifft, die zwischen einer der K.u.k.-Kulturen und einer anderen Kultur getätigt wurden.
In einem nächsten Schritt nähert sich Wolf von verschiedenen Seiten dem Objekt ihrer Forschung. Historisch setzt sie sich mit dem „habsburgischen Babylon“ auseinander, indem sie den Mythos des multikulturellen „Miteinander“ und der gelebten Mehrsprachigkeit unterläuft und darauf verweist, dass „das Konzept des kulturell Anderen im Kontext asymmetrischer Kräfteverhältnisse der beteiligten Kulturen zu berücksichtigen“ (64) sei, dass also zwischen den Sprachen und ihrem Gebrauch sehr wohl politische, soziale Hierarchien bestanden, an deren Spitze das Deutsche stand.
Das folgende Kapitel kann man wohl am besten als eine kurze translatorische Sozialgeschichte der Habsburgermonarchie bezeichnen. Ausgeführt werden in ihm die Begriffe der „polykulturellen Kommunikation“ und der „polykulturellen Translation“. Das erste Konzept, also das der meist mündlichen Zwei- oder Mehrsprachigkeit im Habsburgerreich, wird in zwei Subkategorien unterteilt, in „habitualisiertes Übersetzen“ und in „institutionalisiertes Übersetzen“. Das „habitualisierte Übersetzen“ umfasst die Alltagspraxis jener Bewohner, die in zweisprachigen Gebieten lebten oder in ein anderssprachiges Gebiet siedelten und sich so zwischen zwei oder mehr Idiomen bewegten – dargestellt an DienstbotInnen, Handwerkern und Tauschkindern. Das „institutionalisierte Übersetzen“ betraf vor allem den (bis zu viersprachigen) Schulunterricht, das Heer und die Verwaltung. Die „polykulturelle Translation“ schließlich bezieht sich auf die institutionalisierte, meist schriftliche Übersetzungstätigkeit für Behörden und Ministerien, vor Gericht und von Gesetzestexten aus den und in die unterschiedlichen Sprachen des Reiches, aber auch anderer Länder. Hier werden umfassend alle Tätigkeiten, Institutionen und Personengruppen beschrieben und analysiert, die im engeren Feld der Übersetzung angesiedelt sind: gerichtlich beeidete Dolmetscher und ihre Praxis bei Gericht, die „Terminologiekommission“ in ihrer vielsprachigen juridischen Zusammensetzung ebenso wie die kuriose „Sektion für Chiffrewesen und translatorische Arbeiten“ im Ministerium des Äußern und im Kriegsministerium. In diesem Zusammenhang war die Erziehung der „Sprachknaben“ zu Dragomanen in Istanbul das Vorbild für die Ausbildung von Dolmetschern an der Wiener Orientalischen Akademie, die nicht umsonst nach dem Ende der Habsburgermonarchie zur Diplomatischen Akademie wurde – ein von Wolf ausführlich dokumentiertes Beispiel für die umfassende kulturvermittelnde und -schaffende Tätigkeit der Dolmetscher und Übersetzer.
In eben dieser Mischung aus mündlicher und schriftlicher, privater und offizieller Übersetzungstätigkeit sieht Wolf den kulturkonstruierenden Beitrag der Translationspraxis. Denn „die für die ‚Erfindung‘ des Vielvölkerstaates erforderlichen Identitätskonstruktionen“ werden von den vielschichtigen mehrsprachigen und plurikulturellen Begegnungen neu „kontextualisiert“, wobei, im Sinn von Homi Bhabha, diese kontextuellen Verknüpfungen nicht mehr auf den vorhergehenden Zustand rückführbar sind, sich aber doch „aus Elementen des ‚Zurückgelassenen‘ zusammensetzen“ (189). Im Zusammenspiel von vier Faktoren – den nationalitätenbezogenen Spannungen, der Zwei- oder Mehrsprachigkeit, der Sprach-, Kultur- und Vermittlungskompetenz ihrer Ausführenden sowie der Rolle der an der Translation beteiligten Institutionen – werden, so Wolf, durch ein permanentes „Aushandeln“ die unterschiedlichen Erfahrungshintergründe der beteiligten Subjekte ausgelotet und „kulturelle Festlegungen ermittelt“ (192).
Die folgenden Kapitel sind der konkreten translatorische Praxis gewidmet und untersuchen sozialhistorisch den privaten Übersetzungssektor und die Übersetzungspolitik in der Habsburgermonarchie, wobei hier neben Aspekten wie der Zensur und der in den Kinderschuhen steckenden Urheberrechtsfrage ein langer Abschnitt der staatlichen Kultur- und Literaturförderung gewidmet ist.
Der umfangreiche Schlussteil des Buches stellt eine Analyse der translatorischen Realität im Vielvölkerstaat dar. Eine vielsagende statistische Übersicht über die generelle Übersetzungspraxis ins Deutsche, sowohl der polykulturellen als auch der transkulturellen Translationen, zeigt eine klare Vorrangstellung des Französischen, dem die K.u.k.-Sprachen Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Ungarisch, Italienisch und Polnisch folgen. Nach dem Schwedischen und dem britischen Englisch findet sich als letzte große Sprache der Monarchie das Tschechische, gefolgt von Übersetzungen aus den USA, dem Niederländischen und Portugiesischen. Die Statistik ist, wie Wolf selbst einschränkt, unvollständig, da zu anderen Sprachen bislang noch keine Bibliografien vorliegen, eine Tatsache, die die Schwierigkeiten von so umfangreichen Arbeiten deutlich macht, zugleich aber auch das Tor zu einem weiten Betätigunsfeld öffnet.
Im letzten, vorrangig empirischen Teil ihrer Arbeit beschreitet Wolf schließlich den „Vermittlungsraum italienischer Übersetzungen“. Gestützt auf ein mit 1741 dokumentierten Übersetzungen sehr umfangreiches Korpus, analysiert und exemplarisiert sie anhand der Übertragungen aus dem Italienischen ins Deutsche detailreich ihre theoretischen Ansätze, geht auf den historischen Kontext ein, in dem die Übersetzungen zustande kamen, untersucht das Wechselspiel zwischen der Festschreibung von Topoi, Stereotypen, Klischees und deren kritische Hinterfragung ebenso wie die Paratexte und ihre Bedeutung für die Rezeption der Übertragungen und das Rollenbild der Translatoren. In diesem Zusammenhang stellt Wolf fest, dass die Zahl der Übersetzerinnen prozentuell geringer war als zur selben Zeit in Deutschland, was ihr zufolge „vorrangig auf mangelndes soziales Kapital schließen lässt“ (S. 360), über das Frauen als Übersetzerinnen verfügten.
Michaela Wolfs Studie ist von doppeltem Wert. Einerseits methodologisch, da die Autorin dezidiert interdisziplinär vorgeht und, wie oben ausgeführt, verschiedene Ansätze auf sehr fruchtbare Weise zusammenspannt. Dadurch wird es ihr möglich, die Bedeutung des Übersetzens als Konstitutionsmerkmal des Habsburgerreiches in seinen vielfältigen Formen herauszuarbeiten. Andererseits aber auch inhaltlich, da sie einen Themenkomplex bearbeitet, der bislang in der Forschung kaum die ihm zukommende Beachtung fand, weder im Bereich der Sozialgeschichte noch in den Translationswissenschaften. In beiden Aspekten lässt sich noch viel weiterdenken, -forschen und -schreiben, und es ist zu hoffen, dass Die vielsprachige Seele Kakaniens ein Ausgangspunkt für eine umfassende Auseinandersetzung sowohl theoretischer als auch inhaltlicher Natur sein wird.