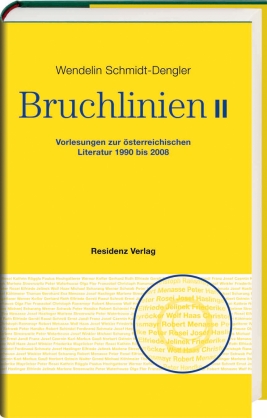Das Buch erweist noch einmal alle Vorzüge von Schmidt-Denglers Literaturanalysen: wie souverän er sein Material erzählen kann, ohne darin zu versinken, wie selbstverständlich die Linien zur antiken Mythologie gezogen werden, wie bruchlos bei der Betrachtung eines Werkes die Vergleiche innerhalb des Oeuvres des jeweiligen Autors/der jeweiligen Autorin, aber auch zu anderen AutorInnen einfließen, aber auch die sich nie in den Vordergrund spielende Methodenvielfalt. Schmidt-Dengler wollte „von Mal zu Mal die Methode wählen, die dem Gegenstand am angemessensten ist“. Darum wusste er auch, wo dem Vergleich Einhalt zu gebieten ist: Er wollte Peter Roseis Wien Metropolis nicht einfach mit Peter Henischs Der schwarze Peter, Gerhard Roths Das Labyrinth und Eva Menasses Vienna vergleichen, nur weil es sich um Wien-Romane aus etwa der gleichen Zeit handelt, denn es „wächst bei thematischer Nähe von Büchern oft das Maß der Unvergleichbarkeit im Ästhetischen, und solche thematischen Irrpfade des Vergleichens sollten wir nicht wandeln, wenn wir die Besonderheit eines Buches fassen wollen“.
Der Focus auf die Besonderheit eines Buches hindert Schmidt-Dengler jedoch nicht, systematische Koordinaten einzuziehen, etwa drei grundlegende Textsorten der modernen Literatur: Verständigungstexte (mit griffigen Themen und Texten, etwa bei Heinrich Böll, Peter Bichsel oder Erich Hackl), Missverständigungstexte (von Goethes Faust über Hölderlin, Büchner, Trakl, Musil und Thomas Mann bis Handke und Bernhard – dem „Trainingsgelände der Literaturwissenschaft“) und Unverständigungstexte („hermetische“, die Kommunizierbarkeit verweigernde Texte etwa bei Konrad Bayer, Oskar Pastior oder Friederike Mayröcker). Gerade im Zugehen auf letztere ist Schmidt-Dengler besonders stark – die Passagen über Mayröcker sind Höhepunkte des Buches, an denen der rationale Methodiker sich vorbehaltlos einem Leseerlebnis öffnet, denn „mitunter muß man sich das unvoreingenommene Leseverhalten des Kindes wünschen, das nicht von dem Zwang bestimmt ist, aus allem einen Sinn herauszudestillieren, der sich für die Lebenspraxis gewinnbringend als Kapital anlegen läßt“. Denn es geht im Werk Mayröckers „um spontane Evidenzen, deren Bedeutung wir verkennen, wenn wir nur auf die Herstellung kausaler Zusammenhänge aus sind“.
Ein anderer Höhepunkt ist die durchgehende Auseinandersetzung mit dem Werk Peter Handkes. Schmidt-Dengler bringt immer auch seine Irritationen ein – vor allem an Don Juan (erzählt von ihm selbst) und an Der Bildverlust, aber er sieht auch das Spezifische dieser „Gegenbücher“ und lässt sich gerade bei diesem noch immer polarisierenden Autor weder für das Handke-Lager noch für seine Gegner vereinnahmen. Und in einer profunden Rezension der Erzählung Die morawische Nacht (die Periode 2005–2008 ist nur in Rezensionen vertreten, es gab kein ausgearbeitetes Vorlesungsmanuskript) weist Schmidt-Dengler deutlich auf Handkes Ironie und Selbstironie hin – ein wichtiger Aspekt, gibt es noch immer Handke-Kritiker wie -Verehrer, die meinen, seine Literatur sei frei von Ironie.
Schmidt-Dengler ist ein wohlabwägender Argumentierer, und wenn es – wie etwa bei Eine kurze Geschichte vom Fliegenfischen von Paulus Hochgatterer oder bei Talschluss von Olga Flor – kontroverse Positionen zu einem Werk gibt, dann lässt er sie erst ausgiebig zu Wort kommen, bevor er erläutert, was seiner Meinung nach für oder gegen das Werk spricht. Und auch bei klarer Kritik wie an Michael Köhlmeiers Abendland stellt er ein Werk nicht als völlig gescheitert hin. Wenn Arno Geigers Es geht uns gut für ihn „einer der besten österreichischen Romane der letzten Jahre“ ist, kann man sich fragen, ob er nicht gelegentlich zu sehr ein Anwalt der AutorInnen ist; aber man lernt von Schmidt-Dengler jedenfalls auch dann, wenn man nicht seiner Meinung ist.
Eine produktive Konstante der Analysen Schmidt-Denglers ist das Werk von Elfriede Jelinek, und dabei geht er gerade auch auf Texte ein, die im Diskurs über die Nobelpreisträgerin nicht so präsent sind, etwa auf Das Lebewohl – ein Dramolett, das Elemente der Rede des Orest zu einer Rede Jörg Haiders werden lässt. Die raffinierte Rhetorik dieses Textes generiert Sätze wie „Wir taten Unrecht, doch jetzt bekommen wir Recht“ oder „Wir sind ausgewählt“ oder „Wir schwören, wir warns nicht, und schon waren wirs wirklich nicht.“ Minutiös analysiert Schmidt-Dengler die Sprache, die syntaktischen Figuren des Textes und zeigt, dass er auf viel mehr zielt als auf Jörg Haider, dass etwa auch „die sehr wohl eingeschliffenen Formeln des Erlösungsdiskurses“ sowie „jene verkrusteten Vorstellungen […], die wir für natürlich und durch den Mythos sanktioniert halten“, getroffen sind. Ebenso fundamental ist Schmidt-Denglers Analyse der Nobelpreisrede von Elfriede Jelinek.
Von Josef Winklers Werken kommt nur Natura morta in den Blick, doch die Analyse dieses Buches weitet sich zu einem Gesamtbild des Schreibens von Winkler, wenn es heißt: „Es ist immer der Körper, der spricht, Winkler hat so eine Art Grammatik des Körpers mit all seinen Organen, den Sinnesorganen wie den Geschlechtsorganen entwickelt, ein Organisches, das stets in ein Künstlerisches überführt wird.“ Nach grundlegenden Aussagen über die Rolle des Schreibens und die Priorität der Form folgt folgendes Resümee über Winklers Literatur: „Hier hat einer ganz genau hingehört und gesagt, was es mit den Leiden, den eigenen und denen der anderen, auf sich hat, und wie sich das sprachlich festhalten läßt.“
Immer wieder werden zentrale Themen angesprochen, etwa der Natur-Diskurs oder das komplexe Verhältnis zur Narrativität (beides vor allem am Gegensatz zwischen Jelinek und Handke). En passant fallen Vergleiche mit der Tradition und schlüsseln literarische Verfahren auf, etwa wenn von Jelinek eine Linie zu Karl Kraus und Nestroy gezogen wird, um Ähnlichkeiten und Unterschiede von Sprachstrategien deutlich zu machen; oder wenn Franzobels Bilder in Bezug gesetzt werden zu jenen Jean Pauls, „der seine Gedanken und seine Handlungen an diese Metaphernlust verlor“.
Vieles an Schmidt-Denglers Vorlesungen müsste man noch hervorheben, etwa dass sie nicht schematisch mit der willkürlichen Jahresgrenze 1990 einsetzen, sondern mit Tod und Erbe Thomas Bernhards und seinem Gegensatz zu Handkes Literaturauffassung; das ausführliche Eingehen auf den noch immer unterschätzten Werner Kofler müsste ebenso erwähnt werden wie der (vielleicht doch zu ungetrübt positive) Blick auf Christoph Ransmayr, auf Robert Menasse wie auf Ernst Jandls idyllen und stanzen oder das große babel,n von Ferdinand Schmatz. Vor allem aber die in mehreren Varianten vorgetragene Überzeugung, „ein Roman ist umso mehr ein Werk der Kunst, je weniger davon eine Inhaltsangabe eine Vorstellung zu vermitteln vermag“.
Bei allen Vorzügen, die Schmidt-Denglers Vorlesungen auszeichnet – eine Literaturgeschichte des Zeitraums 1990 – 2008 sind sie nicht; dazu fehlen allein schon zu viele wichtige Namen: Barbara Frischmuth, Elfriede Gerstl, Walter Kappacher, Gert Jonke, Evelyn Schlag, Norbert Gstrein, Alois Hotschnig oder Michael Donhauser, um nur einige zu nennen, sind nicht einmal erwähnt, H. C. Artmann oder Peter Henisch tauchen nur im Vergleich auf. Aber eine Literaturgeschichte war auch nicht intendiert; Schmidt-Dengler ging es darum, paradigmatisch Textstrategien und Schreibweisen sichtbar zu machen und „die Dimensionen des literarischen Diskurses in Österreich zu beschreiben“. Das ist ebenso unverwechselbar gelungen wie die profunden Werkanalysen. Darum muss man Johann Sonnleitner dankbar sein, dass es dieses Buch gibt. Schade nur, dass sich in sein wichtiges editorisches Nachwort Phrasen mischen wie die von den „wißbegierigen Studenten“ oder „unermüdlicher Fleiß“ und „Dankesschuld“. Und in einem hat Sonnleitner sicher nicht recht: Wenn er konstatiert, dass Schmidt-Dengler „die österreichische Germanistik revolutionierte und sie aus dem Elfenbeinturm der Werkimmanenz herausführte“ und die akademische Praxis durch die intensive Befassung mit der Gegenwartsliteratur nachhaltig veränderte; beides hat schon Walter Weiss (1927–2004) an der Universität Salzburg begonnen, und seine „Schule“ führt das bis heute fort. Schmidt-Dengler, der dabei nachhaltiger öffentlichkeitswirksam war, hat es nicht nötig, dass zu seiner Verehrung andere ignoriert werden. Doch viel bedeutender als dieser Einwand ist die Tatsache, dass Schmidt-Denglers Vorlesungen gedruckt vorliegen. Sie sind ein Bergwerk an Perspektiven, Analysen und Kommentaren sowie ein Maßstab für weitere Interpretationen.