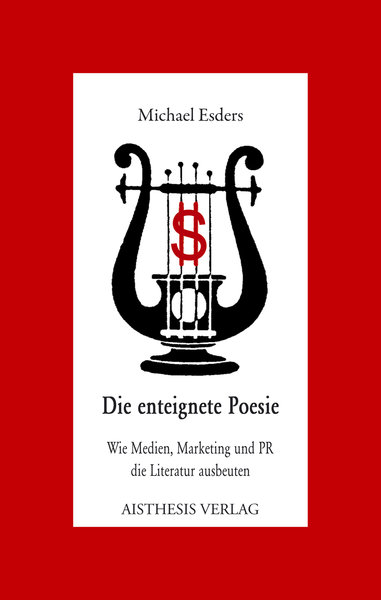Es sind Erzählung, Aphorismus, Drama und Emblem, die Esders als Formatvorlagen der Medien- und Meinungsmacher untersucht. Die werbetechnische Feinarbeit in der Wahl der Sprachmittel wird immer raffinierter und vor allem immer besser getarnt. Selbst jene, die für sprachliche Sensibilität zuständig wären, Schriftstellerinnen etwa oder auch LiteraturwissenschaftlerInnen, vermögen die zeittypischen gesellschaftspolitischen Kampfbegriffe und -techniken oft nicht zu entschlüsseln. Im Bereich der Wissenschaft scheint das übrigens just mit der Umettikettierung der Geistes- zur Kulturwissenschaft verstärkt der Fall zu sein.
Im vorliegenden Band kann man eine Reihe entsprechender Fallbeispiele nachlesen, nicht nur solche von weltpolitischer Tragweite wie die Metaphernproduktion von Politkampagnen (vom „Volkskörper“ bis zur „Achse des Bösen“), sondern so alltäglich harmlose Varianten wie das Begriffspaar Arbeitgeber/Arbeitnehmer, die man genauso gut oder eigentlich richtiger umgekehrt koppeln könnte, schließlich „nimmt“ der Arbeitgeber die Arbeitsleistung, die der Arbeitnehmer ihm zur Verfügung stellt.
Prinzipiell arbeiten (gesellschafts-)politische Mataphern mit abgekürzten Vergleichen und die, so erklärt auch die Neurobiologie, deren Thesen der Autor keineswegs kritiklos gegenübersteht, nehmen immer auch verkürzte Rezeptionswege: gleichsam am reflektierenden Gehirn vorbei direkt ins emotionale Unterfutter.
Eine andere Wiederaufnahme tradierter – bzw. in diesem Fall lange vergessener – literarischer Muster sieht der Autor in der Analogie von Werbebotschaften, Coverkultur oder online-Fotoalben zur Tradition der Emblematik des 16. Jahrhunderts. Mit dieser ersten multimedialen Form versuchte man den Anfangsschwierigkeiten der Lesekompetenz breiterer Bevölkerungsteile mit dem Dreischritt Bild – Überschrift – „Erklärung“ auf die Sprünge zu helfen. Heute werden Bilder in Werbung, Politik, Journalismus und Alltagskommunikation zunehmend mit Headline und Bildunterschrift zugetextet. Aus Bildern als eigenständigem „Text“ mit potentiellem „Rätselcharakter“, den es zu entziffern gilt, wird gerade auch im Internet und hier durch die Community selbst, eine Bild/Text-Flachware, in der das Bild zum bloßen (emotionalen) Verstärker verkommt. Entgegen des prognostizierten Endes des Textes in der Bilderflut, veröden tendenziell beide in der Bildersuppe mit darübergelegter textlicher Endlosschleife.
Das Namens- und Markendesign mit der zunehmenden Mythisierung der Begriff analysiert Esders ebenso wie die Entstehung der Markennamen. An deren Wiege stand übrigens der Schutz des Images, gerade auch in der Schreibkultur. Dem traditionsreichen Nürnberger Bleistiftproduzenten Faber etwa bereiteten die zahlreichen Bleistiftattrappen, für die sich der rufschädigende Ausdruck „Nürnberger Tand“ einbürgerte, viel Kopfzerbrechen. Ab 1840 entwickelte sich deshalb der Brauch, Warenzeichen auf die Bleistifte zu drucken, und 1875 brachte Faber eine Petition ein, die zum ersten verbindlichen Markenschutzgesetz führte.
Vor allem aber untersucht Esders die Folgen des omnipräsenten Storytellings, womit der Literatur gleichsam ihr genuines Feld streitig gemacht wird. Storytelling ist nicht nur das Prinzip jeder Werbebotschaft, es hat schon lange marktsteuernde Funktionen für Firmengeschichten, Managerbiografien oder das Börsengeschehen, wie die Hypes und Crashes seit der New Economy Blase 2000 belegen. Storytelling ist auch die Basis politischen (Sprach-)„Handelns“ geworden, das der kurzen Pointe, also dem Aphorismus ebenso verpflichtet ist wie den Regeln der aristotelischen Poetik. Aus ihr leitet Esders auch die Lust am Szeneklatsch ab: Promis würden die nötige tragische Fallhöhe im Absturz garantieren – die traditionell nur in Zeiten politischen Aufbruchs (Naturalismus, Versismo, „Antiheimatliteratur“ der 1970er Jahre) auch Figuren des „niederen Volkes“ zugestanden wurde. Gerade das ist allerdings mit den Beicht- und Containerformaten in den letzten beiden Jahrzehnten so radikal wie nie aufgebrochen worden.
Die Literatur aber müsse diesen massenmedialen Enteignungsprozessen einen anderen Umgang mit Sprache und ein anderes Erzählen entgegenhalten. Das scheint tatsächlich ein Gebot der Stunde, auch wenn die Literaturwissenschaft – gerade in Österreich – um 1990 just den gegenteiligen Trend euphorisch begrüßt hat. Diese einmütige Begeisterung über das „Es wird wieder erzählt“ sollte ebenso zum Nachdenken anregen wie die Tatsache, dass sprachkritische Konzepte, die einst mit dem Begriff Avantgarde verbunden waren, aktuell radikal ins Out geraten sind. Freilich, und das wäre eine intensivere Beschäftigung wert, liegen die Anfänge der Indienststellung sprachexperimenteller Gags just im Schaffen der traditionellen Avantgarden selbst. Modernisierungsprozessen verpflichtete Akteure sitzen nicht selten selbst den für Zeitgenossen oft schwer durchschaubaren gesellschaftspolitischen Missverständnissen auf, die sie zu unreflektierten Akklamateuren industrieller Entwicklungsschübe machen. Das wird eine spätere Generation vielleicht auch für das Schwellenzeitalter der Neuen Medien zu analysieren haben.