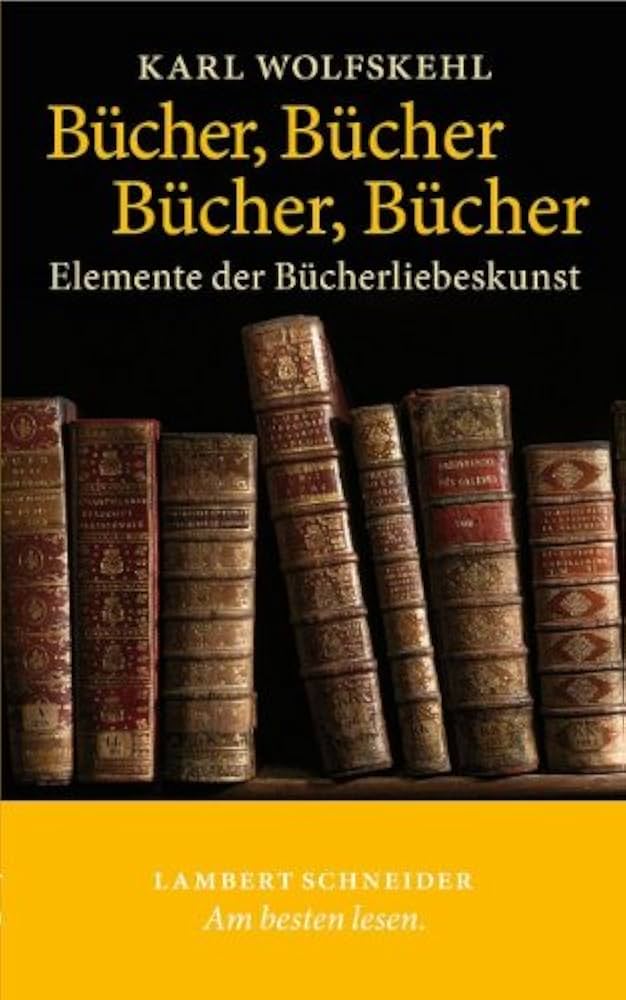„Das Buch ist eine zentrale Kategorie von Karl Wolfskehl.“ Das ist der etwas ungeschickt formulierte erste Satz des Vorworts von Andreas B. Kilcher, das nüchtern, aber informativ die Figur des Bücherliebhabers, -sammlers und Herausgebers bibliophiler Editionen Karl Wolfskehl vorstellt. Geboren 1869 als Sohn einer wohlhabenden jüdischen Bankerfamilie in Darmstadt, lernte Wolfkehl 1892 Stefan George kennen, der immer wieder Gedichte Wolfskehls in den „Blättern für die Kunst“ publizierte. Aus diesem Umfeld erklärt Kilcher auch Wolfkehls grundsätzliche Haltung zum Buch. Es ist ihm ein lebendiger Kosmos mit je eigener Lebensgeschichte, nicht ein bloßes Medium zum Transport von Inhalten, sondern die Inkarnaton des „schaffenden Geistes“ mit einer tendentiell „magischen Strahlkraft“ (S. 18). Dem Buchindividuum schreibt sich seine Geschichte durch den Gebrauch ein und reichert sich in ihm an – nicht nur in Form offensichtlicher Zeichen wie Annotationen und anderer Lesespuren.
Wolfskehl war Mitglied in zahlreichen bibliophilen Vereinen, 1907 war er Mitbgründer der „Gesellschaft der Münchener Buchfreunde“ und bis zum Ausbruch des Ersten Weltkriegs, den auch er stürmisch begrüßte, eine zentrale Figur der Münchner Bohemien-Szene. Nach der Verarmung der Familie durch Krieg und Inflation brachte er sich mit intellektuellen Gelegenheitsarbeiten und als Hauslehrer durch, bis ihn die Machtergreifung durch die Nationalsozialisten ins Exil trieb und ihm Bücher nur als „portatives Vaterland“ und einziger „Bürgerort“ (Heinrich Heine) blieben. Tatsächlich begann er auch im Exil in Auckland, Neuseeland mit dem Aufbau einer neuen Büchersammlung. Die Möglichkeit einer Rückkehr nach Deutschland lehnte er bis zu seinem Tod 1948 dezidiert ab.
Elemente der Bücherliebeskunst ist der Titel des ersten Essays und zugleich Motto wie Thema des gesamten Bandes, der praktische Hinweise zur „Buchbehandlung“ genauso enthält wie Anregungen, worauf man bei der Begegnung mit einem „Buch-Subjekt“ im Sinne Wolfkehls achten soll oder zumindest kann. Als Weihnachtsgeschenk freilich – so konzediert selbst Wolfskehl – ist das „alte Buch“ nur eine spezielle Option, Bücherliebhaber und Leser zu erfreuen. „Die vielbeklagte Abkehr vom Buch, die, zumal verglichen mit dem ungeheuren Bücherbverbrauch der nachklassischen Jahrzehnte, der eigentlichen Bildungsära, ungeheuer scheint: ist sie wirklich so bedenklich?“ So fragt Wolfskehl gegen Ende des Buches und rät zur Zuversicht. Erstpubliziert wurde dieser Text im März 1929. Auf eine Relektüre der Wolfkehlschen Bücher-Hymnen im Kontext der aktuellen Buch-Endzeitstimmung hat das Vorwort leider verzichtet.