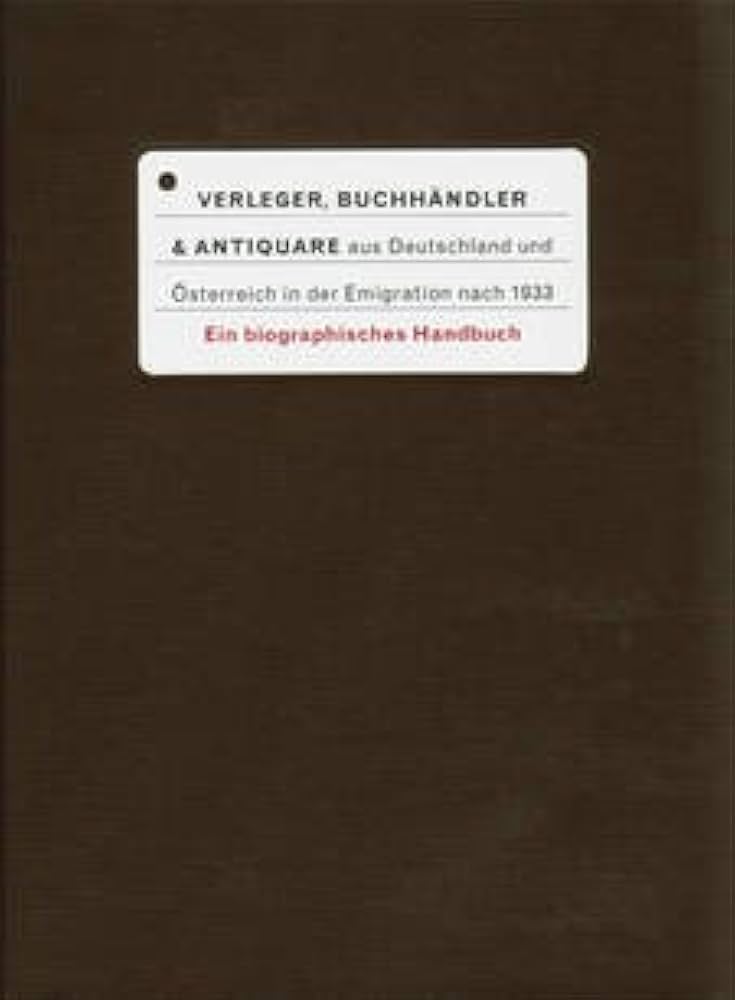Fischer ist im Fach Buchwissenschaft kein Unbekannter, im Gegenteil! Es würde hier zu weit führen, auch nur einen Bruchteil seiner gewichtigen und vielfältigen Publikationen anzuführen und es ist ihm ganz allgemein hoch anzurechnen, dass er bewusst oder unbewusst eine österreichische Note in die bundesdeutsche Buchforschung einbringt. Ja, dass man nicht übersieht, dass Österreich seit jeher der wichtigste Absatzmarkt für in Deutschland hergestellte Bücher ist und dass Österreich auch eine eigene Buchhandels- und Verlagsgeschichte aufzuweisen hat. Fischer ist nicht nur Mit-Verfasser des im Jahr 2000 erschienenen Werkes Geschichte des Buchhandels in Österreich, von ihm wird dzt. ein Band über „Buchhandel und Exil 1933-1945“ in der Reihe Geschichte des deutschen Buchhandels im 19. und 20. Jahrhundert vorbereitet. Der stattliche Band, der hier vorzustellen ist, hat 432 Seiten und ist die Krönung eines Projekts, das vor gut zwei Jahrzehnten in Angriff genommen wurde und parallel zu Fischers sonstiger Lehrtätigkeit, vielen Betreuungen und Projekten entstanden ist. Eine Krönung auch deshalb, weil Fischer selbst zahlreiche „Vorarbeiten“ zum Handbuch publiziert hat.
Das Handbuch weist eine übersichtliche Gliederung auf. Es öffnet mit einem Vorwort von Eberhard Köstler, dem Vorsitzenden des Verbandes deutscher Antiquare e.V., jenem Verein, der auch als Herausgeber fungiert. Auszusetzen an Köstlers Vorwort ist die Tatsache, dass er gleich drei Mal den expliziten Titel leugnet („… aus Deutschland und Österreich …“) und von den „deutschen Antiquaren“, über „aus Deutschland vertriebene Antiquare“ bzw. „das Leben der einst aus Deutschland vertriebenen Buchhändlerkollegen, der Verleger und der Antiquare“ schreibt. Im Gegensatz dazu kann man sagen, dass das Handbuch das hält, was es im Titel verspricht. Von den mehr als 800 Einträgen hat gut ein Viertel einen direkten Österreich-Bezug. Das ist gar nicht so wenig, gemessen an den Größenordnungen des Buchhandels in beiden Ländern. Nicht ganz klar ist der Grund, weshalb der Name des Verfassers, also Ernst Fischer, nicht auf der Titeletikette steht und erst am Titelblatt aufscheint.
Im Gegensatz zu ähnlichen Handbüchern geht das Werk mit dem „Biographischen Teil“ gleich in medias res, d.h. bevor die üblichen editorischen Bemerkungen und Erläuterungen präsentiert werden. Diese folgen am Ende des Biographischen Teils, und auf sie kommen wir noch zu sprechen. Die Begriffe Verleger, Buchhändler und Antiquare werden hier möglichst breit gefasst, was eine gute Entscheidung war. Das Handbuch erfasst somit auch Personen, die z.B. erst im Exil im Buchhandel tätig waren, die nicht Firmeninhaber waren, aber wichtige und interessante Stellungen in einer Firma hatten, die Familienmitglieder waren und manchmal in zweiter Generation sich im Buchhandel betätigten, Angestellte, Lektoren, Literaturagenten. Kurz gefasst: aufgenommen werden alle Personen, die irgendwie als Mittler zwischen Autor und Verleger fungierten. Fischer kann man zustimmen, wenn er meint, eine allzu rigorose Abgrenzung der Personengruppe wäre nicht wünschenswert. Das Handbuch bringt den Vorteil mit sich, dass man Informationen anbieten kann, die im Rahmen einer Gesamtdarstellung des Themas wegfallen müssten. Zumal, wie schon erwähnt, viele der behandelten Personen aus Österreich stammten oder als „Altösterreicher“ zu bezeichnen sind, hat das Handbuch auch für österreichische Interessierte etwas zu bieten. Von den zahlreichen Beispielen können aus der Vielzahl hier nur einige wenige genannt werden: Ernst Angel, George Peter Clare, Hans Deutsch, Martin Flinker, Wolfgang Foges, Martin Freud, Heinrich Glanz, Ludwig Goldscheider, Robert Haas, Bela Horovitz, Walter Neurath, Paul Perles, Frederik Praeger, Felix Reichmann, William Henry Schab, Helene Scheu-Riesz, Joseph und Willi Suschitzky, Herbert Reichner, Frederick Ungar und Paul Zsolnay.
Die Einträge zeichnen sich durch eine angenehme Lesbarkeit aus. Es fehlen z.B. die üblichen, weil platzsparenden, aber bei der Lektüre sonst störenden Abkürzungen, und die Texte sind nicht, was oft der Fall ist, in einem abgehackten Telegrammstil verfasst. Jede Eintragung ist in sich geschlossen, systematisch aufgebaut und durch Literaturangaben abgerundet. Die Artikel weisen eine sehr unterschiedliche Länge auf, was weniger mit der Bekanntheit oder „Bedeutung“ der einzelnen Person zu tun hat, als mit der manchmal dürftigen biographischen Quellenlage. Querverweise im Text der Eintragung führen den Benutzer zu Artikeln über andere Personen im Band. Ja, im Handbuch kann der Leser auch nur schmökern und dabei interessante Biographien kennenlernen. Man trifft auf „alte Bekannte“ genauso wie auf Personen, deren Namen man im Zusammenhang mit einem Verlag, einem Antiquariat oder einer Buchhandlung einmal gehört hat, und Fischer gelingt es, sie zum Leben zu erwecken, indem er sie nach Maßgabe der Quellenlage vorstellt.
Das Handbuch richtet sich wohl an „Insider“ und seien das Menschen in der Buchbranche heute oder Buchwissenschaftler bzw. Personen, die sich einfach für die Geschichte des Buchhandels interessieren. Aber darüber hinaus bieten diese hunderte von Biographien, die erstmals in dieser Ausführlichkeit präsentiert werden, den Ausgangspunkt zu einer unüberschaubaren Palette von Themen, die eine nähere Behandlung verdienen würden.
Am Ende der Einträge folgt der Essay „Die Emigration der Verleger, Buchhändler und Antiquare aus Deutschland und Österreich nach 1933. Eine Vertreibung und ihre Folgen“. Hier versucht Fischer die Frage zu beantworten, worin die Bedeutung dieser Gruppe von Menschen liegt und was von der Auseinandersetzung mit an die 800 Biographien zu erhoffen ist. Für Fischer ist der Vorgang der Vertreibung und Neuetablierung dieser Personen „das einschneidendste und folgenschwerste Einzelereignis in der Geschichte des Buchhandels im 20. Jahrhundert“, und das nicht bloß im deutschsprachigen Raum (361). Das Ziel seines Handbuchs fasst er wie folgt treffend zusammen: „Die vorliegende biographische Dokumentation erfasst 823 Personen, deren Lebensläufe in ihrer Vielfalt und Dramatik ein lebendiges Bild davon vermitteln, was diese Emigrantengruppe nach 1945, bis in die Gegenwart nachwirkend, für den kulturellen Transfer und die internationalen Verflechtungen in der Welt des Buches geleistet hat.“ (361) Wer sonst mit der Buchhandelsgeschichte in diesem Zeitraum nicht vertraut ist, wird hier von kompetenter Seite aufgeklärt.
Fischer bietet dem Benutzer ausführliche Informationen zum Aufbau der Artikel wie auch zu den Quellenangaben. Einer Anzahl von Artikeln liegen Informationen zugrunde, die er bzw. Mitarbeiter aus Interviews und Briefwechseln mit Emigranten oder deren Nachkommen gewinnen konnte. Es versteht sich von selbst, dass der Band ein umfangreiches Quellenverzeichnis aufweist. Es bleiben noch die „Anhänge“ hervorzuheben. Das Handbuch ist durchaus benutzerfreundlich. Die Einträge sind klarerweise alphabetisch geordnet und mit Querverweisen versehen, aber die Register im Anhang erlauben eine tiefere Erschließung des gesamten Inhaltes und ermöglichen viele unterschiedliche Zugänge zum Textkorpus. So dienen etwa „Namensverweise“ dazu, auf andere Schreibweisen oder frühere Namen der jeweiligen Personen hinzuweisen. Das Ortsregister, das nach Kontinent, Land, Stadt geordnet ist, zeigt in seinem Umfang das wahre Ausmaß der meist erzwungenen Emigration aus Österreich und Deutschland, ja an welchen Ecken und Enden der Welt die Buchhändler, Verleger und Antiquare letztlich gelandet sind und gewirkt haben. Schwerpunkte hier waren eindeutig Israel, England und die USA. Der Band schließt mit einem Firmenregister, das es dem Benutzer wiederum erlaubt, Informationen in einzelnen Einträgen für sich zusammenzutragen.
Die Typographie und Gestaltung des Bandes, für die Ralf de Jong verantwortlich zeichnet, hat etwas Edles, etwas Nobles an sich. Das reicht vom Einband mit aufgeklebter Titeletikette bis hin zu Layout und Papier. Die Grundschrift ist sehr angenehm zu lesen und die Namen der einzelnen Einträge werden durch eine rote Schrift optisch hervorgehoben. Die Angaben zur Sekundärliteratur, die am Schluss des Artikels folgen, heben sich durch eine andere, etwas kleinere Schrift ab. Fischers Handbuch ist, nicht zuletzt dank der gefälligen Präsentation, eine faszinierende Informationsquelle und gleichzeitig Lesestoff, der zum Nachdenken anregt.