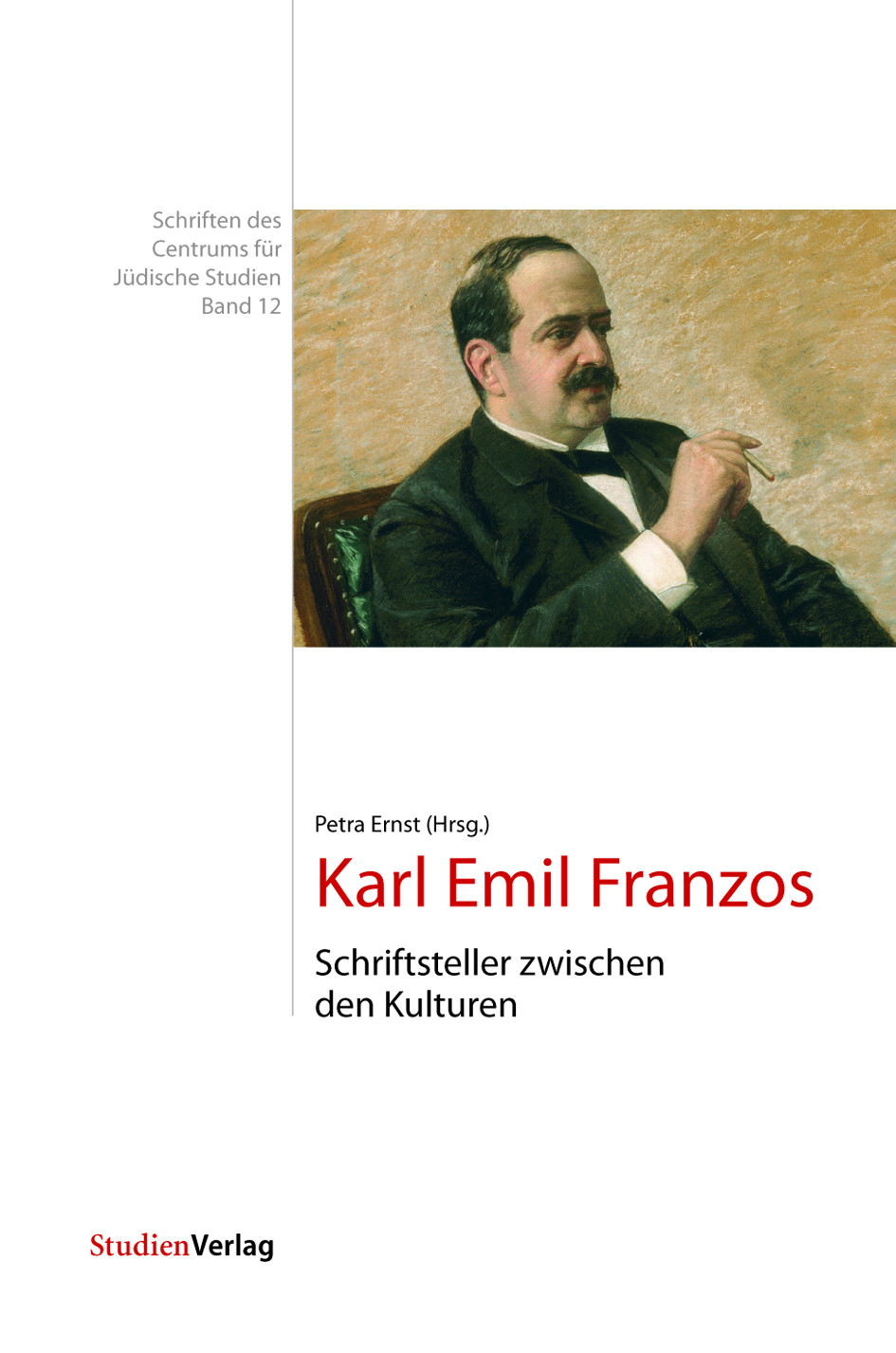Die neun Beiträge haben verschiedene Schwerpunkte, mit starker Konzentration auf die ‚jüdische Seite‘ von Franzos‘ Werk. Im umfangreichen ersten Beitrag (zur „Konstruktion des Raumes“ bei Franzos) allerdings zeigt Alexandra Strohmaier allein, dass sie Assmann, Bachtin, Bhabha, de Certeau, Derrida, Foucault, Genette, Said u. a. m. – hingegen nicht Lacan und Gayatri Spivak – gelesen hat, belegt durch 131 Anmerkungen, zieht aber immerhin gelegentlich das Werk von Franzos heran, als Beleg für deren Theorien. (Eine Probe: „Franzos‘ Konstruktion des Fremdraumes (als hybrider Raum) durch Eingrenzung des/der Fremden korreliert mit einer Konzeption des fremden Körpers als hybrider und ent-grenzter Leib […]“; S. 11).
Die anderen Beiträge sind nüchterner, ihr Erkenntniswert größer. Maria Klanska stellt differenziert Franzos‘ von Klischees nicht freie Einstellung zum ostmitteleuropäischen Judentum dar. Einen speziellen, sehr signifikanten Aspekt dieses Themenfelds untersucht Gabriele von Glasenapp: die Darstellung christlich-jüdischer Liebesbeziehungen, wobei die Verfasserin auch die literarische Tradition des Motivs berücksichtigt; interessant sind hier u. a. Beobachtungen zu den unterschiedlichen Publikationsstrategien von Kompert und Franzos (S. 65f). Die Herausgeberin behandelt das Motiv des (geradezu verbotenen) Lesens (und des Nicht-Lesens) deutscher Bücher, besonders Schillers, im Ghetto, ein Motiv, das in verschiedenen (gründlich analysierten) Erzählungen von Franzos recht unterschiedliche Funktionen hat.
Andrei Corbea-Hoisie charakterisiert auf Grund wenig bekannter Quellen das die Grenze zum Nationalismus überschreitende Deutschbewusstsein des Dichters vor allem am Beispiel seiner Rumänen-Stereotype. Günther A. Höflers Beitrag über den Pojaz als Künstler- und Entwicklungsroman wirft fast als einziger auch einen Blick auf Franzos‘ Erzählkunst. Hildegard Kernmayer stellt dessen bisher kaum unter dem Gesichtspunkt des Genres betrachtete Feuilletons in den Zusammenhang der Entwicklung dieser medienbezogenen ‚Gattung‘, mit einer interessanten Überlegung zum je anderen Charakter der Texte in der Zeitung und im Buch (S. 121).
Eher den Charakter einer (nicht uninteressanten) Miszelle hat der Beitrag von Leopold Decloedt über den Briefwechsel von Franzos‘ Witwe mit dem flämischen Literaten Julius Pée (1871-1951), der in den 1920er Jahren ein Franzos-Buch schreiben wollte. Abgerundet wird der unsere Kenntnisse bereichernde Sammelband durch die Skizze von Claudia Erdheim über „Jüdisches Leben in Ostgalizien zur Zeit von Karl Emil Franzos“. Abschließend: Einen vernünftigen Tagungsvortrag über Franzos zu schreiben ist nicht schwer. Viel schwerer und aufwändiger, aber auch viel wichtiger wäre es einige wichtige Texte von ihm (kommentiert) zu edieren. Gewiss ist Franzos‘ Werk qualitativ ungleich und weist, was hier nicht verschwiegen wird, oft „kolportagehafte Züge“ (S. 67) wie „kulturjournalistische Vereinfachungen“ (S. 106) auf, aber die besten seiner Erzählungen sind nicht nur kulturhistorisch interessant, sondern lohnen die Wiederentdeckung auch unter ästhetischen Gesichtspunkten.