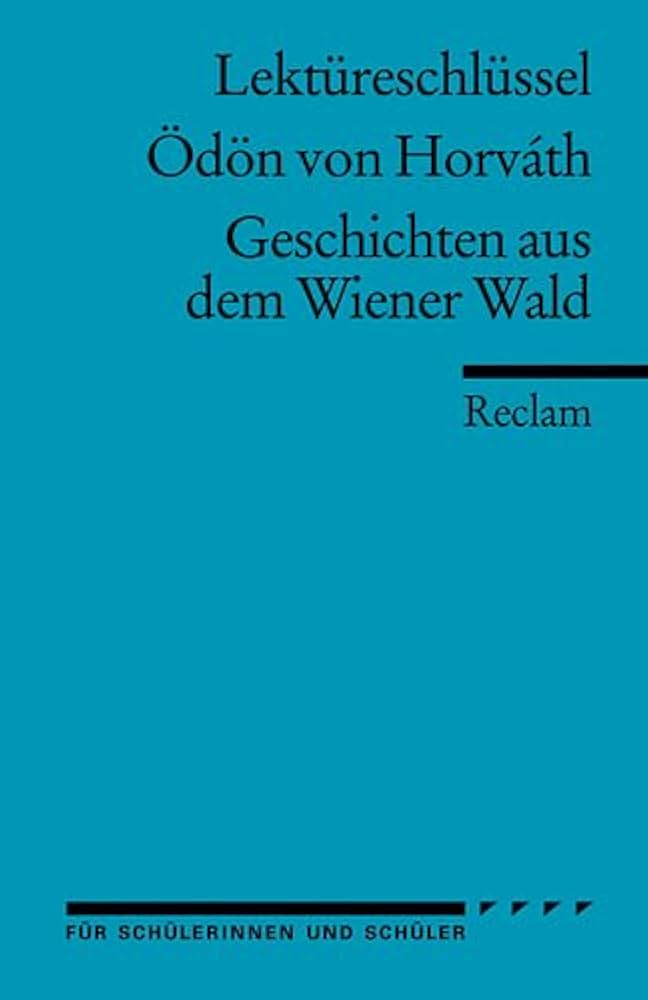Einleitend sorgt eine „Erstinformation zum Werk“ (Kap. 1) für Orientierung, weckt gleichzeitig das Interesse für die Geschichten aus dem Wiener Wald, indem Eisenbeis nachdrücklich das auch in der Gegenwart noch wirksame kritische Potential des Dramas herausstreicht. Dass Marianne allerdings als „harmloses Wiener Mädchen“ eingeführt wird – später wird sie in einer Personencharakteristik treffender als „gescheiterte Rebellin“ bezeichnet -, überzeugt in dieser Erstcharakteristik ebenso wenig wie die Negativbewertung der Gattungsbezeichnung „Volksstück“ als „Etikettenschwindel“. Das hieße ja, dass ein ganz wichtiges Anliegen der Moderne, nämlich das wie auch immer ausgerichtete Unterlaufen von Gattungserwartungen, unter Verdacht gestellt würde.
Sehr genau werden in Kapitel 2 die Inhalte der einzelnen Bilder des Stücks analysiert, mit besonderem Augenmerk auf die topographischen Feinheiten, die Personenkonstellationen sowie die herausragende Bedeutung der detaillierten Bühnenanweisungen Horváths. Was – in Parenthese sei es angemerkt – in einem Arbeitsbuch für Schülerinnen und Schüler nicht passieren sollte – ist allerdings der ständige Wechsel zwischen (falschem) Präteritum und (korrektem) Perfekt als Vorzeit zum Präsens in der Inhaltsangabe, gelegentlich sogar innerhalb eines Satzes. Das Kapitel 3 vertieft die Ausführungen zur Personenkonstellation, die die ausgefeilte Komposition eines „Dreieckspiels zwischen Marianne, Oskar und Alfred“ ebenso erkennen lässt wie die erst in der „Versöhnung“ = „Katastrophe“ des Schlusses aufgehobene Parteiung der zur „Stillen Straße“ gehörenden Personen einerseits, der zur „Wachau“ zugeordneten andererseits. Es ist genau diese Konstruktion des Stücks, die die Defizite der innerfamiliären Beziehungen für die Rezipierenden eindrucksvoll ins Bewusstsein rückt (die Skizze des Verfassers zur „Personenkonstellation“ ist entbehrlich, weil im Vergleich zu seinen Ausführungen nicht sehr anschaulich und wenig aufschlussreich).
Marianne als zentraler Hauptfigur des Stücks wird folgerichtig besondere Aufmerksamkeit geschenkt. Die Männer, einschließlich ihr Vater, handeln sie jeweils aus egoistischem Kalkül (aber ohne Erfolg) als „Ware“. In der engstirnigen, profitorientierten kleinbürgerlichen Gesellschaft mit ihren desaströsen zwischenmenschlichen Verkehrsformen muss Marianne, wie Eisenbeis nachdrücklich betont, mit ihren Wünschen sowohl in ihren Beziehungen als auch beruflich scheitern. Genauer zu erklären wäre jedoch Mariannes „Wunsch nach Emanzipation“. Man könnte meinen, er verdanke sich einem kognitiven Akt, tatsächlich handelt sie rein gefühlsmäßig. Beweis dafür ist, dass sie unter Ausblendung jeglicher verstandesmäßigen Regung im Strizzi Alfred einen „Gottgesandten“ sieht. Auch ist nicht ohne weiters nachvollziehbar und bedürfte ebenfalls genauerer Ausführung, dass das Kind „Symbol von Mariannes Versuch der Selbstverwirklichung“ sein soll und dass Hierlingers Meinung über Frau und Beruf eine „ironische Umkehrung“ der Auffassung des Zauberkönigs darstelle. Hingegen werden dieser und Oskar sehr treffend charakterisiert, der Vater Mariannes mit seiner moralischen Fassadenhaftigkeit und mit seinen Versuchen, durch eben diese und durch „vermeintliche Bildung“ seinen gesellschaftlichen und ökonomischen Niedergang zu vertuschen, der Bräutigam in seinem religiös kaschierten Sadismus und in seiner Ausstrahlung von Unheimlichkeit. Weniger überzeugt die Auffassung, Alfred habe auch „positive Eigenschaften“. Das ist wohl eine Frage der Lesart, denn seine durchaus passablen „Manieren“ und seinen „Charme“ setzt er gezielt für seine egoistischen Interessen ein, sie sind wohl kaum als Charakterzüge eines „feinen Menschen“ (wie ihn Marianne in Verkennung der Situation nennt) zu interpretieren. Zuzustimmen ist hingegen der Deutung Hierlingers und Havlitscheks als Komplementärgestalten von Alfred beziehungsweise Oskar sowie des Misters als einer Person von sentimental verträumter Brutalität. Auch die Großmutter in ihrer verlogenen, einen mörderischen Charakter verschleiernden Bigotterie ist treffend charakterisiert, hinzuweisen wäre vielleicht noch darauf, dass Horváth mit dieser Zeichnung das Klischee vom lieben Großmütterlein, wie es in den traditionellen Volksstücken gerne gepflegt wird, unterläuft.
Sehr anschaulich analysiert das 4. Kapitel den „Werkaufbau“, die Gliederung, den zeitlichen Ablauf, die „Kreisstruktur“ und die „Fassadendramaturgie“ (im Sinne von Ingrid Haag). Interessant auch der Hinweis, dass einige „relativ kurze Bilder“ dramaturgisch an „Filmszenen“ erinnern. „Wort und Sacherklärungen“ (Kapitel 5) sind immer ein Problem. Was soll, was muss erläutert werden, was kann als bekannt vorausgesetzt werden. Wissen Schüler, was „derangiert“ bedeutet, können sie mit der Regieanweisung summt den „Trauermarsch“ von Chopin etwas anfangen? Sind ihnen Ziehrers Walzerlied Sei gepriesen, du lauschige Nacht und diverse Wienerlieder vertraut zuzuordnen, wissen sie, was „Schrammelmusik“ ist? Zu diesen Musikstücken finden sich keine Erläuterungen, wohl aber zu Mendelssohn Bartholdys Hochzeitsmarsch, zu Puccinis Bohème, zum Donauwalzer sowie zum Radetzkymarsch. Eine ähnliche Uneinheitlichkeit lässt sich beim Nachweis der Bibelsprüche erkennen. Die Entscheidung, was zu erläutern ist und was nicht, wird wohl immer subjektiv sein, aber die Kriterien von Eisenbeis sind nicht durchschaubar. Manche der Erläuterungen erscheinen auch etwas zu knapp: So wird „stante pede“ zwar korrekt mit „stehenden Fußes“ übersetzt, aber können Schüler mit diesem Ausdruck etwas anfangen? Ebenso darf man bei einigen Austriazismen wie „Bist daneben?“ oder „verhunzen“ zweifeln, ob sie allgemein verständlich sind. Dankbar nimmt man hingegen Hinweise an wie den auf Georg Herwegh als Verfasser des bei der Verlobungsfeier vorgetragenen Gedichts Die Liebe ist ein Edelstein (diese Angabe vermisst man sowohl in Christine Schmidjells ausführlichen „Erläuterungen und Dokumenten“ zu den Geschichten bei Reclam als auch bei Dieter Wöhrle in der kommentierten Ausgabe des Stücks in der „Suhrkamp BasisBibliothek“, beide auch auf das Zielpublikum Schüler und Studierende ausgerichtet).
Im Kapitel 6, „Interpretation“, widmet sich der Verfasser den wichtigsten Aspekten der Geschichten, den Differenzen zum traditionellen Volksstück, Horváths zentralem Anliegen der „Demaskierung des Bewußtseins“, seiner Definition von „Dummheit“ als verweigerter Bewusstseinsveränderung, der Differenz der Geschlechter, der Perversion religiöser und moralischer Ansprüche, dem Zusammenhang von „ökonomischen Wertvorstellungen und Sexualmoral“, dem vom Autor so genannten „Bildungsjargon“ und seiner wohlkalkulierten Dialoggestaltung, dem Zusammenhang von Komik und Unheimlichkeit, der besonderen dramaturgischen Bedeutung von „Stille“ („Totenstille“), verschiedenen Symbolen und Motiven (speziell etwa Bildern des Todes), dem gezielten Einsatz von Musik und dem epischen Charakter des Stücks. Einzig beim letztgenannten Aspekt wäre eine genauere Auskunft wünschenswert. Dass Horváth in seinem Stück „deutlich unauffälliger“ mit epischen Elementen arbeitet als Brecht, sagt recht wenig aus. Diese Differenz herauszuarbeiten, wäre für eine Schärfung des dramaturgischen Verständnisses von Schülerinnen und Schülern recht nützlich.
Im Kapitel 7 werden „Autor und Zeit“ vorgestellt, die Folgen der gesellschaftlichen und ökonomischen Krisen nach dem Ersten Weltkrieg in ihren Auswirkungen auf den „alten Mittelstand“, bei dem sich eine Kluft auftut zwischen gesellschaftlichem Sein (tatsächlich Niedergang) und Bewusstsein (trügerisches Gefühl der Zugehörigkeit zu gehobenem Bildungsbürgertum) und der sich anfällig zeigt für faschistische Ideologie. Das 8. Kapitel schließlich gibt einen kurzen Überblick über die Rezeption der Geschichten – von der bei der ernstzunehmenden Kritik (Kerr, Kästner) durchaus positiven Aufnahme der Berliner Uraufführung über den Skandal bei der Wiener Aufführung 1948 (die als Verunglimpfung des Wienertums verstanden wurde) zur Horváth-Renaissance Ende der 1960er, Anfang der 1970er Jahre, als man das Stück dann auch in Wien umjubelte. Die Tatsache der neuen Wertschätzung unterstreicht Eisenbeis mit Verweisen auf Handkes „Nacherzählung“ von Horváths Stück unter dem Titel Totenstille beim Heurigen (1971) sowie auf die Schell-Verfilmung (1979). Die im Vergleich wesentlich attraktivere Verfilmung für das Fernsehen von 1961, also im Vorfeld der angesprochenen Wiederentdeckung des Autors, wird bedauerlicherweise nur am Rande erwähnt.
Eisenbeis bietet abschließend noch eine 32 Fragen umfassende, für den Unterricht recht nützliche Checkliste (Kapitel 9) an. Positiv zu vermerken wäre auch, dass er sich auf die von Kastberger und Streitler besorgte Edition der Geschichten in Reclams Universal-Bibliothek bezieht, die sich bereits auf die Ergebnisse der Arbeit an der kritischen „Wiener Ausgabe“ stützt, deren Erscheinen in naher Zukunft zu erwarten ist. Im großen und ganzen liegt mit dem „Lektüreschlüssel“ ein zwar aufgrund des Vorliegens der genannten Kommentare von Schmidjell und Wöhrle nicht zwingend notwendiger weiterer Unterrichtsbehelf, aber ein doch trotz einiger kleiner Mängel recht brauchbares Arbeitsbüchlein vor.