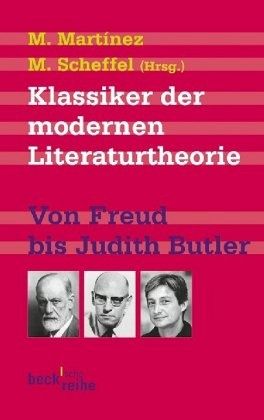Waren es bei Schmid Šklovskij, Ejchenbaum, Tynjanov, Jakobson,Mukarovský, Barthes, Bachtin, Kristeva, Genette, Derrida, de Man, Gadamer, Staiger, Ricœur, Hamburger, Booth, Stanzel, Dilthey, Lukács, Benjamin, Luhmann, Bourdieu, Goldmann, Foucault, Habermas, Freud, Lacan, Lotman, Iser, Jauß, Butler, Said, Bhabha, Greenblatt, Bordwell/Thompson, Deleuze und Manovich, so werden nun bei Martínez und Scheffel von jeweils einer Wissenschaftlerin bzw. einem Wissenschaftler folgende Theoretiker/innen vorgestellt: Freud, Lukács, Tynjanov, Propp, Bachtin, Jakobson, Hamburger, Gadamer, Adorno, Barthes, Lotman, Foucault, Luhmann, Bourdieu, Derrida, Genette, Said und Butler. Auffallend dabei ist, dass Martínez und Scheffel bei annähernd demselben Umfang nur halb so viele Theoretiker/innen präsentieren als Schmid, demnach dem Schaffen einer Denkerin oder eines Denkers etwas mehr Raum gegeben werden kann. Dass es dabei „schmerzhafte Lücken“ in Kauf zu nehmen gilt, thematisieren die beiden Herausgeber auch in der Einleitung, denn man hätte auch – wie auf Seite 10 nachzulesen ist – zu Baudrillard, Benjamin, Booth, Eco, Frye, Greenblatt, Greimas, Heidegger, Lacan, Lévi-Strauss, de Man, Mukarovský, Simmel, Spitzer, Šklovskij, Staiger oder Williams einen Beitrag verfassen können (oder – wie der Rezensent noch anfügen möchte – zu Holland, Ingarden, Geertz, Ejchenbaum, Kristeva, Ricœur, Stanzel, Dilthey, Goldmann, Habermas, Iser, Spivak, Jauß, Bhabha, Deleuze, Cixous, Irigaray, Schmidt und und und).
Diese „schmerzhaften Lücken“ sind jedoch keineswegs so schmerzhaft, denn erstens gibt es genügend überblicksartige Einführungen in die und Darstellungen der Literaturtheorie (und mit dem Klassiker von Horst Turk, der bis ins 17. Jahrhundert zurückgreift, inzwischen auch drei, die Theoretiker/innen vorstellen), und zweitens legen es Martínez und Scheffel keineswegs darauf an, einen Überblick über Literaturtheorien des 20. Jahrhunderts zu präsentieren. Dass es neben der mit vier Seiten sehr kurzen Einleitung (die weder den Theoriebegriff expliziert noch theoretische Richtungen vorstellt) auch keine weiteren zusammenfassenden Texte oder zusammenführenden bibliographischen Angaben mehr gibt, wird also keineswegs als Fehlen wahrgenommen, sondern ganz im Gegenteil als Freiheit von Ballast – es liegt also ein Sammelband im besten Sinne des Wortes vor.
Erfreulich ist auch, dass die beiden Herausgeber ganz bewusst nicht einen didaktischen Zweck in den Vordergrund rücken, der das Denken von „Diskursbegründern“ (S. 8) in oft zu vereinfachender und verkürzender Form auf Fragen der Anwendbarkeit und Praktikabilität herunterbricht, sondern in einer Art Ad-fontes-Bewegung die Theorien gleichsam unverstellt von ihrer Rezeption durch allerlei Adept/inn/en, Schulen und Moden zu fassen versuchen. Wer die komplexen und manchmal durchaus auch widersprüchlichen Gedanken der einzelnen Theoretiker/innen nachvollziehen möchte, ist mit dem Buch bestens beraten, wer etwas schnell Umsetzbares für einen Einführungskurs sucht, das auch ohne Voraussetzungen verständlich ist, sollte die Anfänger/innen vorab besser mit einer Einführung in die Literaturtheorie konfrontieren.
Die einzelnen Beiträge folgen durchwegs demselben und erfrischend altmodisch wirkenden Muster „Leben/Werk/Wirkung“. Treffend wird dabei dargestellt, dass die Lebenswege der Personen nicht unwesentlich waren und sind für jene Theorien, die sie entwickelten und entwickeln. (Ausdrücklich hervorgehoben seien die biographischen Informationen, die ansonsten manchmal nur schwer zu finden sind.) Bei der Minderheit der Theoretiker/inne/n, denen die biographischen Umstände nur eine vergleichsweise kurze Zeitspanne der Arbeit ermöglichten, mag diese Darstellung auf dem knappen zur Verfügung stehenden Raum vielleicht nicht allzu schwierig sein, die Mehrzahl der vorgestellten Denker/innen haben jedoch verwickelte Wege zurückgelegt, ein heterogenes und oft widersprüchliches Werk vorgelegt und vielfältige Wirkung ausgelöst. Die große Qualität des Bandes liegt nun darin, Beiträge zu versammeln, die Leben, Werk und Wirkung der Theoretiker/innen in ausreichender Differenziertheit auf 20-25 Seiten vorstellen. Einige der Beiträge sind vielleicht manchmal etwas sperrig und bringen nur wenig zur Sprache, was nicht woanders auch zu finden wäre, andere wiederum sind in ihrer Verständlichkeit, Klarheit und detaillierten Genauigkeit herausragend: Stellvertretend seien nur die über Lukács (von Linda Simonis), Foucault (von Achim Geisenhanslüke) und Derrida (von Peter V. Zima) genannt.
Die Beiträge sind recht voraussetzungsreich verfasst. (So gelang es dem Rezensenten etwa nicht herauszufinden, zugegebenermaßen bei einer etwas oberflächlichen Recherche, was mit dem Motiv der »Urinschwemme« – das Bachtin erörtert habe (S. 121), im Beitrag zu diesem Theoretiker leider nicht weiter erläutert wird – gemeint sein könnte. In der Schweiz wird der Begriff heute, wie die 13 mageren Ergebnisse bei Google zu zeigen scheinen, für den unerfreulichen Zustand nach Stadtfesten mit großem Zulauf und viel Alkoholkonsum verwendet.) Aber das stört allenfalls diejenigen, denen der Sinn nach Crashkursen steht. Wer Fundiertes, Qualitätsvolles und Differenziertes zu den genannten Denker/innen sucht, ist hier auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Jetzt würde sich der Rezensent nur mehr, wenn er denn eine Bitte zum nahenden Weihnachtsfest formulieren dürfte, eine mehrbändige Ausgabe (Dünndruck ist auch erlaubt) auf den Gabentisch wünschen, welche die drei Bände von Turk, Schmid und Martínez/Scheffel vereint und vielleicht auch noch zwei, drei weitere noch anfügt, in dem auch noch andere Theoretiker/innen beschrieben werden.
Und wenn einmal endgültig geklärt werden könnte, ob Bachtin wirklich ein Buchmanuskript – dessen Kopie beim Verlag 1941, wie die Legende sagt, während der deutschen Invasion der Sowjetunion verbrannte – zu Zigarettenpapier verarbeitet habe, wodurch der überwiegende Teil des Textes als verloren gegangen gilt, der würde den Rezensenten, der nun wirklich nichts Wichtigeres zu bekritteln finden kann, vollends glücklich machen.