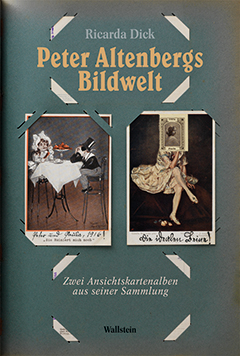Auch wenn Titel und Hauptteil des schmalen Buches zwei Ansichtskartenalben Altenbergs in den Mittelpunkt rücken, verbergen sich viele spannenden Neuigkeiten im ersten Kapitel, das Briefe an Ännie Holitscher aus den literarischen Anfängen ebenso auswertet – aus denen etwa Altenbergs Besuch bei Freud im Oktober 1887 belegbar wird – wie den bislang völlig unbekannten Briefwechsel mit Paula Schweitzer. („Der Mann hat eine Liebe — die Welt! Die Frau hat eine Welt — die Liebe!“ So lautet die Widmung an Paula Schweitzer, die Altenberg am 10. Dezember 1911 am Semmering in sein neues Buch „Neues Altes“ schreibt, das Exemplar befindet sich im Bestand der Bibliothek der Dokumentationsstelle.) Das Literatur- und Kunstinstitut Hombroich beherbergt nicht nur die beiden hier präsentierten Bilderalben, die sich im Privatbesitz befinden, sondern neben vielen anderen Brief(abschriften) auch 109 Briefe Paula Schweitzers an Peter Altenberg im Original und 75 Gegenbriefe Altenbergs in Abschriften aus dem Zeitraum vom 15. März 1914 bis zum 28. Oktober 1918.
Damit können einige der Mythen ad acta gelegt werden, die Altenberg als begnadeter Poseur und Eigenvermarkter – als solchem wäre seinen Selbstaussagen gegenüber immer schon größere Skepsis angesagt gewesen – begründet hat und die von der Literaturwissenschaft übernommen wurden. Deutlich wird etwa aus Briefen an Ännie Holitscher, dass seine literarischen Anfänge keineswegs der Vorstellung eines abrupten Start up entsprechen. „S. Fischer druckte mich, also wurde ich“, lautet Altenbergs Sprachregelung dazu, doch dem ging eine längere Phase voraus, in der er sich äußerst aktiv und ungeduldig bei den Gatekeepern der Zeit Gehör zu verschaffen trachtete. „Was ist mit Bahr? Jeder Tag ist ein Verlust; sollte man nicht den Passus: die genialen unter Ihnen, wie Ibsen und G. Hauptmann für diesen Mann streichen oder auch seinen Namen dazu setzen?“, schreibt er am 24. Dezember 1891 an Ännie Holitscher. Eine Korrektur erfährt auch der Zeitpunkt, an dem Altenberg seine Familie verließ – sein erster Versuch, selbständig zu leben scheiterte und er kehrte rasch wieder ins Elternhaus zurück.
Ricarda Dick präsentiert all diese neuen Erkenntnisse und Korrekturen am gängigen Altenberg-Bild sympathisch unaufgeregt und ohne jede Geste des Auftrumpfens. Korrigiert werden muss offenbar auch die Zahl der erhaltenen Fotoalben: es scheinen acht zu sein. Den Hauptteil des Buches bildet die genaue Beschreibung samt ersten Analysevorschlägen der beiden Alben aus 1915/16 und 1917/18, eine Zeit, die mit Hilfe des entdeckten Briefwechsels neu lesbar wird. Ricarda Dick verzichtet auf jede moralische Stellungnahme zum Gegenstand ihrer Forschung, das betrifft die in den Alben versammelten Kinderpornografica ebenso wie das weitgehende Ausblenden der Entstehungszeit. Altenbergs patriotische Begeisterung mag 1917/18 abgeflaut sein, aber die wenigen eingefügten (Anti)Kriegspostkarten, kontrastiert mit Blumendarstellungen und verbunden mit dem Rekurs auf Andreas Hofer als seinem Inbild für die „adeligen Geisteskräfte“ des Mannes, können als Reflexion seiner Position von 1914 nicht recht überzeugen.
Instruktiv ist die vorangestellte Analyse von Altenbergs eher oberflächlicher, auf keinen Fall systematischer Beschäftigung mit Bildender Kunst oder Fotografie, zeitgenössischen Diskursen über dieses neue Medium stand er eher fern. Altenbergs eigenwillige Begrifflichkeit von „Natur/Natürlichkeit“ und „Kunst/Künstlichkeit“ bleibt auch in Bezug auf seine Sammlungsobjekte in sich widersprüchlich; mit der unterschiedslosen Nutzung differenter Medien, die entgegengesetzte Bezüge zu Künstlichkeit/Natürlichkeit repräsentieren – Postkarte, Bildkarte, Kunstkarte, Fotografie – weist er für sich jede Kategorisierung zurück. „Ihn interessieren kaum die Kunst oder die Fotografie an sich; beide dienen primär und vor allem dem Transport von (inneren) Bildern.“ (S. 105) Das bleibende Gemeinsame ist – abgesehen von späteren Umstrukturierungsarbeiten, die schwer nachvollziehbar sind – mit der Eingliederung in die Albumseite gegeben. Im Falle von Altenbergs Alben kommt bei einem Teil der eingefügten Bildwerte die Einverleibung durch den Arrangeur mittels Beschriftung hinzu, samt dem Eigentums- und zugleich Urhebernachweis „PA“. Wie nahe Altenberg der „endlosen Unterwelt des populären Kitsches“ (Willy Haas, S. 31) steht, zeigen oft gerade diese Bildbeschriftungen; wo sie nicht autobiografische Bezüge herstellen, setzen sie die abgebildeten Stimmungswerte oft intentionsgemäß um und unterscheiden sich dann kaum von jenen, die von den Herstellern selbst aufgedruckt wurden. In den 32 reproduzierten Albumseiten, die dem Band angefügt sind, findet sich gleich auf zwei Karten mit melancholischen Landschaftsdarstellungen die von Altenberg ergänzte Bildbeschriftung „de solitudine; blühende Landschaften erhalten wiederholt die Inschrift „Frühling“ („Ver“).
„Beide Alben sind voll künstlerischen Ausdrucks, der auch den heutigen Betrachter in seiner Kraft und Originalität anspricht – wohl gerade weil sie keiner Zeitströmung folgen“, heißt es im Verlagstext. Doch könnte man das auch umgekehrt interpretieren: Sie folgen der Zeitströmung der trivialen Bildproduktion – inklusive der unter den Ladentischen gehandelten Kinderpornografica, für die sogar Goethes Mignon herhalten musste – so eng, dass sie einen guten Einblick liefern in diese wenig dokumentierte Form zeittypischer Massenmedien. Altenbergs Alben fallen zeitlich in die Blütezeit der Bildkartenproduktion, als neue Drucktechniken die Herstellung verbilligten und jedes kleine Dorf vom Angebot der fahrenden Fotografen Gebrauch machte und eine Ansichtskarte des Ortes herstellen ließ – so wie heute keine noch so kleine Gemeinde auf einen eigenen Web-Auftritt verzichtet. Interessant sind die Alben auch als Bildkommentare zu Altenbergs literarischem Werk – zahlreiche der eingefügten Ansichtskarten sind als Illustrationen seiner Skizzen – und deren Titel – lesbar. Hier ist von einer systematischen Analyse und Parallellektüre einiges zu erwarten.