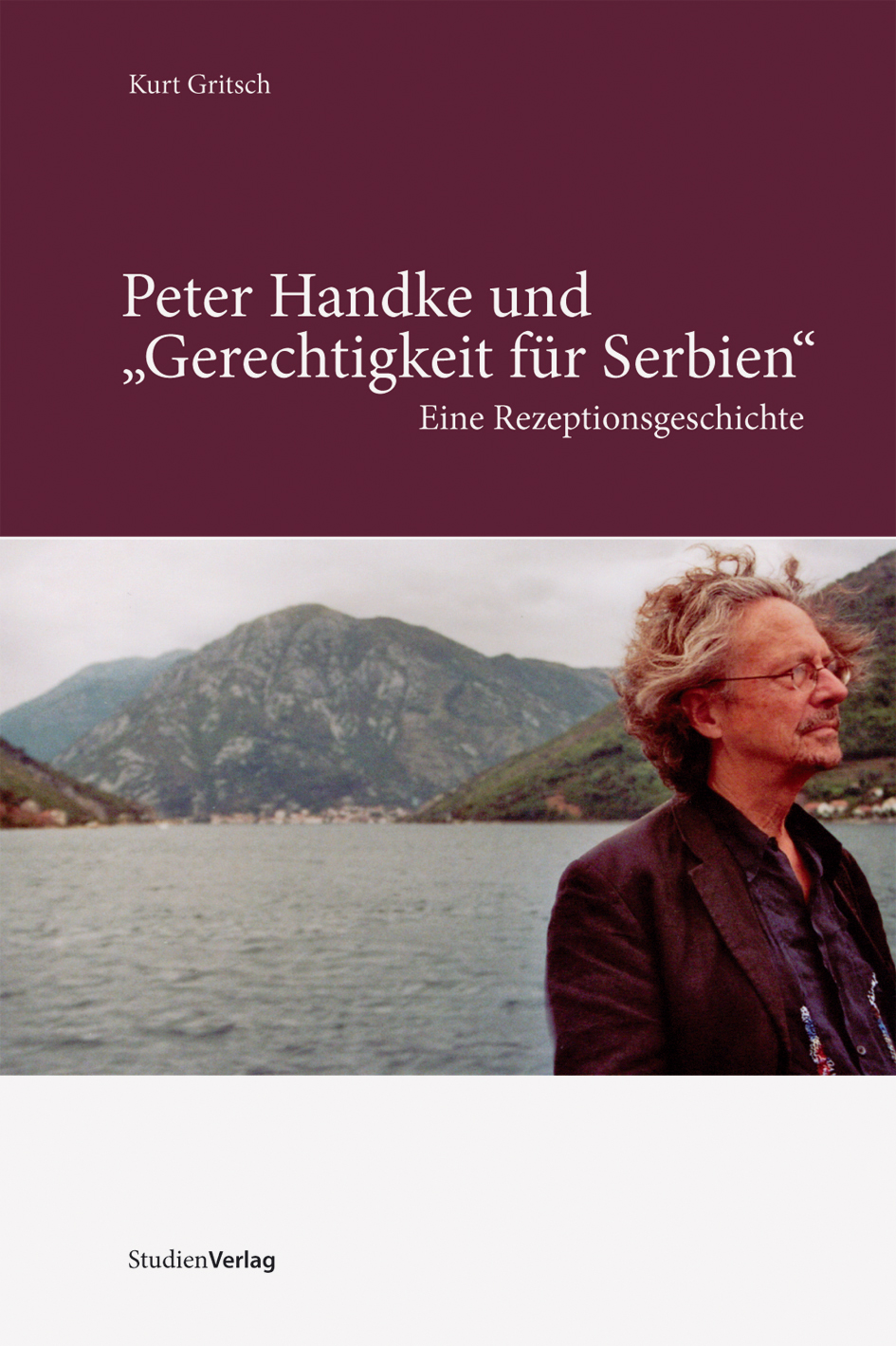Die Spuren Sloweniens und Jugoslawiens sind in vielen literarischen Texten Handkes zu finden, von einem „Engagement“ des Schriftstellers – wenn auch nicht im Sartre’schen Sinne – im Rahmen der Auseinandersetzung mit (Ex-)Jugoslawien kann man jedoch erst ab Anfang der 1990er-Jahre sprechen. Wurde Handkes Slowenien-Text „Der Abschied des Träumers vom Neunten Land“ (1991) noch recht wenig wahrgenommen, so schlug sein Serbien-Text „Eine winterliche Reise zu den Flüssen Donau, Save, Morawa und Drina oder Gerechtigkeit für Serbien“ (1996) hohe Wellen und erhitzte die intellektuellen Gemüter in vielen europäischen Staaten. Die allermeisten Stimmen zu diesem Text – wie der erstgenannte wiederum in der Süddeutschen Zeitung erstpubliziert – gingen mit Peter Handke hart ins Gericht, schien er sich doch nicht nur in unzulässiger Weise auf die Seite der Serben zu schlagen (die Mitte der 1990er-Jahre in der medialen Berichterstattung der meisten westlichen Medien fast durchwegs als ‚die‘ Bösen wahrgenommen wurden), sondern wurde durch die Beschreibung des ‚Wirklichen‘ (im Gegensatz zur Geschichte, zum medialen Konstrukt, zum Bild etc.) verdächtig, einer nahezu mystischen Haltung gegenüber dem Authentischen, Natürlichen und Wahren zu huldigen.
Die Auseinandersetzung rund um das Jugoslawien-Engagement Handkes war mit „Gerechtigkeit für Serbien“ (und den Reaktionen darauf) noch lange nicht vorbei, publizierte der Autor doch nicht nur weitere Texte zum Thema, sondern verstörte das Publikum noch mehr durch seinen Besuch beim Begräbnis Slobodan Miloševićs im Frühjahr 2006. Die Aberkennung des Heine-Preises der Stadt Düsseldorf wenig später war der letzte Höhepunkt der schon lange zur ‚Debatte‘ geronnenen Diskussion. Der 2009 erschienene Kosovo-Text „Die Kuckucke von Velika Hoča“ wurde im Vergleich zu den früheren Texten weit weniger (und vor allem auch weniger kontrovers) wahrgenommen.
Gritsch widmet sich in seinem Buch weder der gesamten ‚Handke-Jugoslawien-Debatte‘ noch dem Text „Gerechtigkeit für Serbien“, vielmehr stellt er dessen Rezeption in Printmedien ins Zentrum. Da diese Rezeption zwar vehement und umfangreich, aber doch auch zeitlich begrenzt war, ist es durchaus legitim, den Zeitraum der untersuchten Zeugnisse mit der Jahrtausendwende im wesentlichen zu Ende gehen zu lassen.
Problematisch wird diese Begrenzung allerdings dann, wenn Gritsch die historische Literatur zu den Balkankriegen der 1990er-Jahre, die nach 2000 erschienen ist, nicht mehr berücksichtigt. Selbst wenn nach 2000 keine geschichtsumwälzenden Entdeckungen mehr gemacht wurden, so wurden doch viele Vermutungen in den letzten zehn Jahren verifiziert bzw. falsifiziert, Details präzisiert und Behauptungen untermauert. Viele Stellen in Gritschs Text, in dem es um die faktischen Ereignisse geht, muten daher mit ihren vorsichtigen Formulierungen (etwa: „Aussagen von UNO-Mitarbeitern zufolge …“) und ihrer zeitlichen Kontextualisierung (etwa durch die Bemerkung, das sei „aus heutiger Sicht nicht zutreffend“) etwas seltsam an, wenn man die neun Jahre bedenkt, die zwischen dem Erscheinen des Buches im Jahre 2009 und dem Erscheinen der zitierten Literatur (vor 2000) liegen – bei Ereignissen, die gerade mal 10 bis 15 Jahre zurückliegen, doch ein beachtlicher Zeitraum.
Entscheidend wird dies bei der Beurteilung von Ereignissen, deren Diskussion extrem kontroversiell verlaufen ist – wie etwa die Ermordung von über 8.000 Muslimen durch Truppen der bosnischen Serben im Juli 1995 nach der Eroberung der UNO-Schutzzone Srebrenica. Gerade bei solchen Ereignissen ist präzise Information zentral. Und da diese teilweise erst nach 2000 nach und nach zugänglich und systematisiert wurde, fällt ihr Fehlen – auch wenn es bei Gritsch gar nicht um die Faktenebene gehen mag! – doch ins Gewicht.
Der Qualität von Gritschs Analyse der Reaktionen auf Handkes „Gerechtigkeit für Serbien“ tut dies keinen Abbruch, wobei man den Text von Handke gut kennen und sich auch im Chaos der Thematisierung der Balkankriege der 1990er-Jahre und der ganzen ‚Handke-Debatte‘ bereits einigermaßen zurechtgefunden haben sollte. (Es empfiehlt sich die Lektüre des ausgewogenen 4. Kapitel zur Geschichte des Balkans als Einstieg; sehr informativ und erhellend ist auch der Anhang mit der Aufzählung der Ereignisse in (Ex-)Jugoslawien zwischen 1986 und 1999.) Gritsch vermag vor allem durch Vollständigkeit und Detailreichtum zu punkten: Mit Fug und Recht ließe sich behaupten, mit diesem Buch eine Aufarbeitung nahezu aller Reaktionen zu Handkes Serbien-Text in den Printmedien zu finden, wobei Gritsch auch die Reaktionen Handkes auf die Reaktionen sowie die Reaktionen der Kritik auf Handkes Reaktionen darauf (zum Beispiel im Zuge seiner Lesereise) ausführlich beschreibt. Dass Gritsch dabei auf eine Systematisierung verzichtet, erschwert zwar die Lektüre, macht aber sehr wohl Sinn: Zeigt er doch so eindrücklich, dass weder ‚die‘ Geschichte noch ‚die‘ Bedeutung eines Textes homogene und objektive Tatbestände wären, sondern sich eine heterogenes und widersprüchliches Gebilde namens „Geschichte“ oder „Textbedeutung“ vielmehr erst in einem verwickelten und konfliktgeladenen Hin und Her von Deutungsauseinandersetzungen und -kämpfen bildet.
Gleichzeitig führt Gritsch empirisch vor, wie der Literaturbetrieb funktioniert und wie sich Interpretationen entwickeln, einschleichen, bilden, verändern, verfestigen. Gritsch schreibt als Historiker und blendet die literarische Ebene des Handke-Textes weitgehend aus (auch wenn er erfreulicherweise nicht den Fehler der allermeisten Rezensenten begeht, diese zu leugnen), aber der literaturwissenschaftliche Gewinn der Arbeit ist doch beachtlich und liegt im wesentlichen in zwei Ergebnissen (ohne dass diese im Buch explizit gemacht würden): Erstens gelingt Gritsch der Nachweis, dass Bedeutungen eines Textes nicht in diesem alleine zu finden sind, sondern erst in der extrem vielschichtigen und konflikthaltigen Lektüre des Textes entstehen. Zweitens wird klar, dass die Debatte um Texte (und ihre Bedeutungen) enorm wichtig ist, denn letztlich werden sie in einer solchen Interpretationen nicht nur geschaffen, sondern auch ausdifferenziert. Wenn man zugesteht, dass es der Erinnerung an historische Ereignisse nicht anders geht als Textinterpretationen, dann wird mit dem Buch von Gritsch deutlich, dass es die ständige Diskussion über Geschichte ist (und nicht ihre Musealisierung und Konserverierung), welche die Geschichte für die Gegenwart erst furchtbar macht. Mit Urteilen über die Handke-Debatte hält sich Gritsch zurück. Als Leser, der sich eine Entscheidung erwartet, ob denn nun Handkes Kritiker oder nicht doch Handke selbst Recht gehabt hat, mag man davon enttäuscht sein, aus einer historischen Perspektive ist die Vorsicht Gritschs konsequent und erinnert an einen Ausspruch Michel Foucaults, der von sich behauptete, ein „glücklicher Positivist“ zu sein, also einer, der empirische Daten beschreibt ohne sie zu bewerten oder zu theoretisieren. Gritschs Vorgehen mag konsequent sein, allerdings vermisst man letztendlich doch ein wenig die kritische Interpretation der ganzen Debatte. Dort, wo Gritsch diese Interpretation wagt, lässt sich Sympathie für Handkes Position erkennen: Völlig zu recht stellt Gritsch fest (wenn auch zum Thema Erich Fried und Vietnam – gleiches gilt jedoch im Analogieschluss für Peter Handke), dass der, der die mediale Berichterstattung über den Krieg kritisiert, nicht in die Kriegsgebiete reisen muss (und auch nicht in der Form über Fakten berichten muss, wie es ein Kriegsberichterstatter tut oder tun sollte): Das Lesen von Zeitungen und die Rezeption der TV-Nachrichten genügen im Grunde, denn Medienkritik ist Sprachkritik und nicht Interpretation der Fakten.
Gritschs Kritik an den Rezensenten Handkes erfolgt also zu Recht, aber leider schießt er an der einen oder anderen Stelle über das Ziel hinaus: Den Kritikern Peter Handkes – mit recht ‚kräftigen‘ Formulierungen wie „Gleichschaltung“, „Herrschaftsgefüge“, „repressive Zentren“ etc. -, vorzuwerfen, sie würden die Freiheit der Kunst gefährden, gehört in das Repertoire jener „Totschlagargumente“, die man zu Recht vielen Gegnern Handkes ankreidet. Die Jury-Entscheidung im Rahmen der Vergabe des Heine-Preises 2006 politisch auszuhebeln, ist zwar demokratiepolitisch ein bedenklicher Vorgang, aber man muss nicht gleich „Zensur“ schreien, denn zum Glück (und noch) darf Peter Handke (im Rahmen des Grundgesetzes) schreiben und veröffentlichen, was er will – und seine Kritiker ebenso. Und wenn die Zeitungen von links bis rechts Ähnliches über „Gerechtigkeit für Serbien“ schreiben, dann muss man noch lange nicht „innere Gleichschaltung“ oder „leicht nachweisbare Druckausübung seitens der Politik“ (S. 158) vermuten: Vielleicht liegt es ja doch auch teilweise am Text.
Gritschs Medienkritik – er widmet ihr ein eigenes Kapitel („Das westliche Jugoslawien-Bild der 1990er Jahre“) – ist aber voll und ganz berechtigt, zeigt er doch (anhand der Tatsache, dass es bereits sehr früh kritische Stimmen in Printmedien und Rundfunk gab, die nicht dem gängigen Bild von der Alleinschuld Serbiens und der Republika Srpska entsprachen), dass Interpretationen von Ereignissen (in der Kriegsberichterstattung) in einem Widerstreit liegen, wobei das, was ‚wirklich‘ passiert ist, bei der Frage, wer sich bei der Deutung von Ereignissen durchsetzt, nur ein Faktor unter vielen ist. Ebenso berechtigt ist Gritschs Kritik an der Gleichsetzung serbischer Lager mit nationalsozialistischen Konzentrationslagern. Bei aller Vorsicht – die Gritsch auch walten lässt – zu sagen, dass die Folterungen und Morde in den serbischen Lagern nicht ’so schlimm wie‘ die Verbrechen der Nationalsozialisten waren, ist zutreffend, darf aber nicht so weit führen, dass man suggeriert, dass diese ’so schlimm‘ nicht gewesen sind. Dieser Suggestion unterliegt Gritsch nicht, aber doch hätte er vielleicht noch deutlicher herausstreichen sollen, dass sie gefährlich ist und von vielen, die eine proserbische Position eingenommen haben, als politisches Argument ins Spiel gebracht wurde.
Gritsch dies als Versäumnis auszulegen, wäre allerdings perfide. Sein Buch ist (und bleibt) ein wichtiger Beitrag zur ‚Handke-Debatte‘.