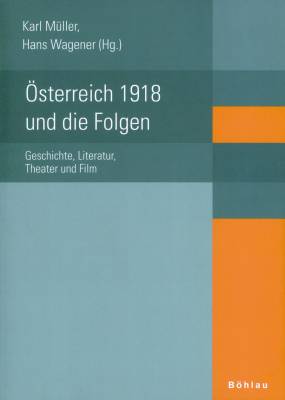Im 2008 erschienenen Band zur Film-Edition von Hugo Bettauers „Die freudlose Gasse“, veröffentlichte Siegfried Mattl einen Beitrag über „Geldentwertung und moralische Revolte“, in dem er als einziges literarhistorisches Referenzwerk den 1981 erschienenen Sammelband „Aufbruch und Untergang. Österreichische Kultur zwischen 1918 und 1938“, herausgegeben von Franz Kadrnoska, heranzog. Dieser Band ist ein Viertel Jahrhundert alt; in der Zwischenzeit sind eine Vielzahl von Einzeluntersuchungen zu österreichischen AutorInnen erschienen und auch Neueditionen und -entdeckungen von Gina Kaus bis Vicki Baum oder Walter Serner, aber tatsächlich kein Versuch einer Neulektüre der Epoche.
Das vorliegende Buch bietet nach einigen anderen Sammelbänden zum Thema spannende neue Einzellektüren und thematische Vermessungen der Epoche; es wird wohl noch einiger Unternehmen dieser Größenordnung bedürfen, bis ein umfassendes neues Epochenprofil gewagt werden kann. Wie der Titel des Bandes sagt, gehen die einzelnen Beiträge vom „Einhieb von 1918“ aus – diese Formulierung findet sich an drei Stellen des Bandes, zweimal richtigerweise Doderer zugeschrieben, sie entstammt seiner so genannten „Athener Rede“, erschienen 1953/54 (S. 7 und 69), und einmal Ingeborg Bachmann (S. 123).
Die politischen und mentalitätshistorischen Folgen des Zerfalls der Habsburger Monarchie analysiert der Historiker und Psychoanalytiker Peter Loewenburg, während Béla Rásky in einem sehr originellen Beitrag die unterschiedlichen Erinnerungskulturen in Österreich und Ungarn in Bezug auf ihre gemeinsame Vergangenheit parallel liest. Für Österreich ergibt sich mit dem Blick von Ungarn aus eine völlig andere Perspektive auf die Entwicklung nach 1945 als die der Literarhistorie vertraute: „Wir brauchen nur dort fortzusetzen, wo uns die Träume eines Irren unterbrochen haben [… wir brauchen] nicht voraus, sondern nur zurückzublicken“ hatte Alexander Lernet-Holenia 1945 in der Zeitschrift „Der Turm“ verkündet, und zumindest personell ist in der Kulturpolitik der 1950er Jahre ein Anknüpfen an den Austrofaschismus evident. Rásky konstatiert für Österreich nach 1945 ein Verweigern jeder Kontinuität durch Rückgriff auf vordynastische Zeiten des Spätmittelalters, was er an der Inszenierung der ersten urkundlichen Erwähung Ostarrichis 996 zum Geburtsschein der Zweiten Republik festmacht. Das sei einhergegangen mit dem Überschreiben der Geschichte der Habsburger Monarchie mit Anekdoten. Das ist eine ebenso bedenkenswerte Sichtweise wie die Tatsache, dass das bürgerliche Publikum in Wien alljährlich beim Neujahrkonzert „den Marsch jenes Radetzkys“ mitklatscht, „der half, die bürgerlich-nationale Revolution 1848 niederzuschlagen, während im Unterschied dazu der ungarische Fernsehkommentar fast jedes Jahr einen verbissenen historischen Kommentar über die Rolle Radetzkys damals nachschieben muss.“ (S. 49)
Robert G. Weigel analysiert in seinem Beitrag zwei unbekanntere Texte Hermann Brochs, „Die Straße“ und seinen 1919 in der Zeitschrift „Der Friede“ veröffentlichten Aufsatz „Konstitutionelle Diktatur als demokratisches Rätesystem“, und zeigt damit, wie hoffnungsvolle Anfänge mit den revolutionären Ereignissen in den gesellschaftlichen und ökonomischen Deregulierungen der krisenhaften 1920er Jahre zur Diagnose des „Zerfalls aller Werte“ führte, der im Zeichen der Resignation bald rechte wie linke Intellektuelle erfüllte und den Boden für den Nationalsozialismus vorbereiten half. Helga Schreckensberger analysiert drei literarische Verarbeitungen der ostjüdischen Zuwanderung – Hugo Bettauers „Stadt ohne Juden“, Joseph Roths „Juden auf Wanderschaft“ und Franz Werfels Fragment gebliebene Erzählung „Pogrom“ – und zeigt auf, wie alle drei Texte, wenn auch auf unterschiedliche Art und Weise im positiven oder negativen auf gängige Vorurteile und Stereotype des Antisemitismus bezogen bleiben. Bettauer, so die Autorin, nehme „die antisemitischen Beschuldigungen gegen die Juden beim Wort“, spinnt sie bis zur „vollsten Konsequenz“ weiter, „um sie so ad absurdum zu führen“. Das ist ein interessanter Erklärungsversuch, der beim Wiederlesen des Romans vielleicht nicht ganz zu überzeugen vermag. Eine interessante Neulektüre unternimmt Wolfgang Nehring am Beispiel von Franz Theodor Csokors „Dritter November 1918“, er nähert sich dem viel zitierten und wohl wenig gelesenen Stück eher skeptisch und entbirgt nach einer eingehenden Analyse eine doch überraschend komplexe Bedeutungsstruktur. Evelyn Deutsch-Schreiner setzt das Jahr 1924 als Schnittpunkt, es ist das Jahr der vorübergehenden ökonomischen Konsolidierung, und es ist das Jahr der Internationalen Theaterausstellung neuer Theatertechnik, das neue Raumkonzepte ebenso sichtbar machte wie neue Formen der Theater- und Körperpräsentation, denen nicht nur die konservative Seite, sondern auch die sozialdemokratische Kunststelle – abgesehen von einigen vorsichtigen Annäherungen – eher skeptisch gegenüberstand.
Karl Müller knüpft an Friedrich Achbergers Analyse von 1981 an und den von ihm konstatierten drei epochalen Grunderfahrungen: Verlustgefühl, Revolution und drohende soziale Deklassierung durch die galoppierende Inflation: Dem wäre aus heutiger Forschungsperspektive freilich eine vierte Grunderfahrung hinzuzufügen, die der Befreiung und des Aufbruchs, die vor allem von Autorinnen thematisiert wurde, die in diesem Beitrag nicht vorkommen. Anschaulich ist Müllers Lesart von der multiplen Persönlichkeit als Folge der deregulierten Verhältnisse, die sich in Romanen von Josef Roth und Hugo Bettauer, Rudolf Brunngraber und Robert Neumann nachweisen lässt. Bettauer gilt gemeinhin – auch für Müller – als Vertreter der Trivialliteratur; vielleicht liegt ein zentraler Schlüssel für einen neuen Blick auf die Epoche in dieser Festschreibung verborgen: Die Schublade Trivialliteratur lässt AutorInnen wie Ottoy Soyka, Maria Peteani, Vicki Baum oder Joe Lederer – sie fehlen auch im vorliegenden Band – leicht übersehen, deren Werke zumindest zum Teil eindeutig der so genannten Neuen Sachlichkeit zuzurechnen sind. In diesen Romanen oder auch in den Epochenporträts von Sir Galahad, Oskar Maurus Fontana oder auch Grete von Urbanitzky sind die „Spiegelungen der Zeit“ besonders dicht und aussagekräftig und können als Erkenntnishilfen für die Epoche und ihr fatales Ende im Faschismus dienen. Vielleicht bedarf es einer Neudefinition des „Trivialromans“ um eine Neubewertung der ganzen Epoche – auch im Vergleich mit der im deutschen Raum anerkannten Literatur der „Neuen Sachlichkeit“, wo die Grenzen für diese Art der „Trivialromane“ vielleicht durchlässiger war.
Vom privaten Erleben des „Habsburger Reiches in der Familie“ geht Maria-Regina Knechts Blick auf zeitgenössische Texte von Bettina Balàka und Helene Flöss aus, der „Weltgeschichte in Erinnerung“ aus dem Hier und Jetzt untersucht. Lesenswert sind die beiden filmhistorischen Beiträge, von Fatima Naqcvi über „Postimperiale und postnationale Konstellationen in den Filmen Michael Hanekes“, und Robert von Dassanovsky, der eine Fülle von filmischen Sichtweisen auf 1918 und die Folgen analysiert. Verfilmungen von Roths „Radetzkymarsch“ kommen hier ebenso vor wie von Gerhard Fritschs „Moos auf den Steinen“ bis hin zu Stefan Ruzowitzkys „Die Siebtelbauern“, die Oscar-bedingt vielleicht näher lagen als „Die Alpensaga“ von Peter Turrini und Wilhelm Pevny oder die für das Thema 1918 und die Folgen unerlässliche „Staatsoperette“ von Otto M. Zykan und Franz Novotny.