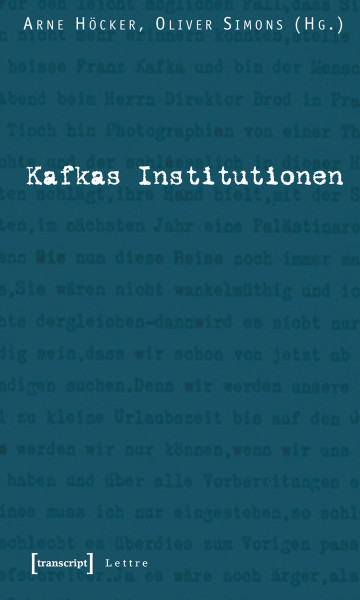„Niemals ist es möglich alle Umstände zu bemerken und zu beurteilen“, zitieren Arne Höcker und Oliver Simons aus einer Tagebuchnotiz Kafkas. Aber die Umstände sind bemerkenswert, die von den AutorInnen herangezogen werden, um die Institutionengeschichten neu zu lesen. Bemerkenswert ist ihre Vielfalt durch die Rückgriffe auf Textvarianten, auf prominente und weniger prominente Kafkalektüren, auf zeitgenössische Schriften und aktuelle Theorien zu Verfahren und Institution. Bemerkenswert sind die Wege, mit denen diskursive Stränge und intertextuelle Bezüge zu Texten Kafkas hergestellt werden. Und bemerkenswert sind die Ergebnisse, die sich nie wiederholen und über immer neue Perspektiven auf Institutionen und Geschichten auch die Aktualität begründen, die Kafkas Werk eignet: im Bereich der akademischen Betriebsamkeit wie der literarischen Form, im Reich der Strafen und der Scham, beim Übertritt ins Fremde und der vermeintlichen Heimkehr.
Immer wieder stehen die Institutionen der Wissenschaft im Mittelpunkt des Interesses und damit grundlegende Zwänge in der Arbeitswelt der BeiträgerInnen und des Zielpublikums dieses Buches. So geht Erhard Schüttpelz der Erfolgsgeschichte von Kafkas „Bericht für eine Akademie“ in Varieté und Universität auf den Grund und fragt nach den Mechanismen, die in beiden Institutionen gleichermaßen wirksam sind. Der Autor skizziert die Geschichte der Allegorie des akademischen Affen, untersucht aber auch die Bedingungen, die ihn realiter in der Akademia oder auf Forschungsreisen auftreten lassen. Ins universitäre Interieur richtet auch Rembert Hüser seinen Blick und geht über die Provokationen Martin Krippenbergers und seiner Installation „The Happy End of Franz Kafka’s ‚Amerika'“ akademischen Konventionen nach: Konventionen des „Vorsingens“, der Wiederverwertungspraxis, Lektürevorschriften oder dem „fortwährenden Orgeln der Klassikernamen“. Weniger frech, aber auch sehr fundiert setzt sich John T. Hamilton im Kontext der zeitgenössischen Institutionalisierung der Musik mit Kafkas Wissenschaftskritik auseinander, die mit Augenmerk auf die ungehörte Musik darauf abzielt, „jener Kunst einen Ort zu sichern, die von Natur getrennt ist.“
Weitere zumeist diskurshistorische Beiträge widmen sich dem Bereich der Justiz. Immer sind es neuralgische Punkte des modernen Rechts- und Gerechtigkeitsverständnisses, die in Kafkas Poetik als solche festgemacht werden und die nach wie vor brisant geblieben sind. Kafkas Texte werden als Auseinandersetzungen mit der damals diskutierten Advokatur gelesen, in der es um den Zwang gesetzlicher Vertretung geht, oder mit der noch jungen neuen Strafprozessordnung. Benno Wagner spürt in Kafkas Texten der „Säkularisierung des Opfers“ nach, wie es in der Versicherung oder im Sozialstaat realisiert und in stete Imperative der Aufopferung transformiert wird. Die von Kafka in koloniale Peripherien verlegte Problematisierung der Abschaffung der Folter lässt über die rechtshistorische Kontextualisierung genuin deutsche Rechtsgeschichte reflektieren, wie Thomas Weitin vorführt. Umgekehrt wird von John Zilcosky über die Rekonstruktion der populären Vorstellungen der Landvermessung Kafkas „Schloß“ zur Auseinandersetzung mit Kolonialismus und seinen Machtstrukturen.
Indem die Literatur im historischen Kontext gelesen wird, ist auch das Widerständige der Texte Kafkas Thema der Beiträge oder, wenn man so will, Kafkas literarische Strategie sich der Hegemonie und den Zwängen herrschender Diskurse zu entziehen. So zeigt Benno Wagner, wie der Autor jene „Ökonomie des Opfers […] der biopolitischen Monetarisierung des Lebens entgegenhält“, die das individuelle Leben sichert. Sein Beitrag führt anhand der „Forschungen eines Hundes“ Kafkas politische Positionierung vor, mit der er gegen die Verwaltung der europäischen Minderheiten auf die Zivilgesellschaft setzt – was eine eminent aktuelle Herausforderung darstellt. Ähnlich brisant geblieben erscheinen jene Verführungen, die Kafka als „koloniale Vorschrift“ verspürte, der er aber, wie John Zilcosky zeigt, mit dem Bruch der gängigen Kolonialästhetik widersteht bzw. „entweicht“.
Wie Franz Kafka für seine politischen Grundanliegen, insbesondere für die Macht- und Schuldfragen in der institutionalisierten Moderne, das Genre des Romans veränderte sowie Möglichkeit und Unmöglichkeit des Erzählens thematisierte, wird im zweiten Teil des Buches untersucht. Anschaulich gemacht wird es über das „Fehlläuten der Nachtglocke“ auch unter Rückgriffen auf die Traumforschung in der Erzählung „Der Landarzt“ sowie mit Sklovskijs und Luhmanns Verfahrensbegriffen in der „Beschreibung eines Kampfes“. Ebenso aufschlussreich sind die Beiträge zu Kafkas „epischem Theater“, das auch in einer Tagebuchnotiz nachgewiesen wird, die Untersuchungen der buchstäblich eingesetzten Systemmetapher „In der Strafkolonie“ sowie der Aufsatz zum Aspekt der Fürsprache, mit dem die Immanenz von Kafkas Prosa belegt wird.
So demonstrieren die AutorInnen, dass die Mittel der Literatur äußerst tauglich, wenn nicht unverzichtbar sind, um politisches und individuelles Leben in und mit Institutionen überhaupt zu hinterfragen. Sie zeigen aber auch, dass es notwendig ist, Einengungen auf disziplinäre Konventionen zu vermeiden. Mit Kafka bringen die BeiträgerInnen aus den Departments of Germanic und Instituten der Literaturwissenschaften verschiedenste Zwänge provokant und kritisch zur Sprache und liefern mit diesem Buch den Beweis, dass man sich diesen Regeln auch widersetzen kann: v.a. durch das Einbeziehen anderer Disziplinen und Textsorten aus Rechtsgeschichte und Institutionentheorie, Musikwissenschaften und Populärliteratur, sicherlich auch durch das Parodieren und Reflektieren der eigenen Zunft. Wie bei Kafka geschieht das mit großem Gewinn.