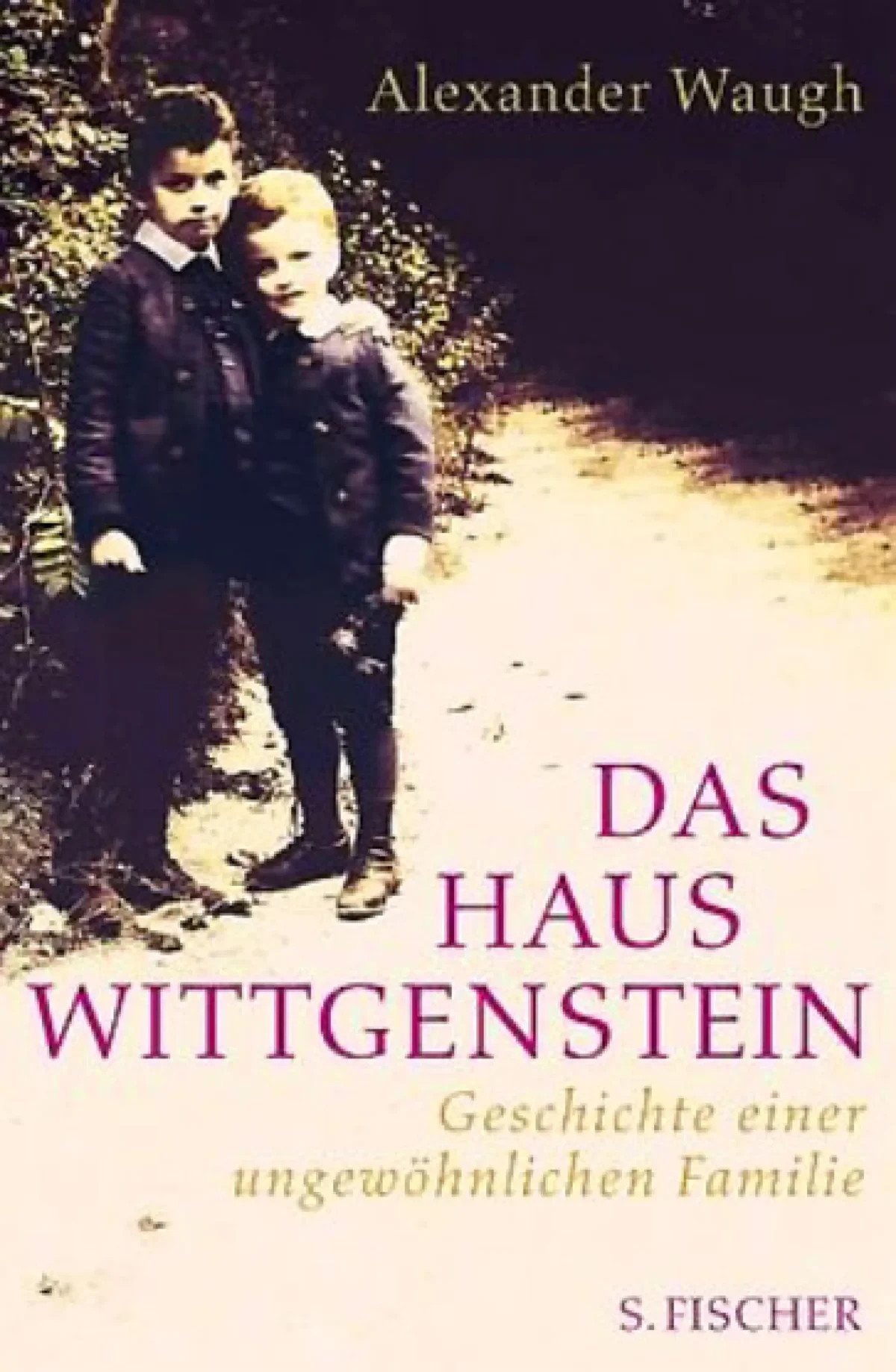Die überaus reiche Familie Wittgenstein kann als ‚Vertreterin‘ jenes gehobenen Wiener Bürgertums gelten, das die Kultur und das gesellschaftliche Leben Wiens im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts entscheidend prägte und im Nationalsozialismus nicht nur an Bedeutung verlor, sondern unterging: Galten die Wittgensteins doch nach den Nürnberger Gesetzen als „Volljuden“, selbst wenn die jüdische Herkunft sowie die jüdische Kultur und Religion in der Familie nie eine Rolle spielte; vielmehr ist bei einigen Wittgensteins sogar ein deutlich ausgeprägter Antisemitismus zu bemerken, den Waugh nicht verschweigt. Eindringlich erzählt Waugh von der Angst, den Überlebenskämpfen und den Erfahrungen von Kriegsgefangenschaft, Exil und Trennung, denen die Wittgensteins ab den 1930er Jahren ausgesetzt waren, und die auch – und gerade? – für begüterte Familien extreme Einschnitte in den jeweiligen Lebensentwürfen bedeuteten.
Waugh zeigt, dass dieses durch Handel und Industrie reich gewordene Bürgertum Menschen hervorbrachte, die nicht nur brillante Denker, Künstler und Manager, sondern auch teilweise herrische und arrogante Persönlichkeiten waren – und die Wittgensteins sind ein ausgezeichnetes Beispiel dafür. (Hervorzuheben ist auch, dass Waugh nicht nur die Eltern der Wittgensteins – Karl und Leopoldine –, sondern auch jene weniger bekannten Familienmitglieder würdigt, deren Leben nicht so schillernd wie jenes von Paul und Ludwig Wittgenstein verlaufen ist.)
Dass die Mitglieder einer solchen Familie auch untereinander Konflikte auszufechten hatten, wird in diesem Buch nicht ausgeblendet: Waugh verschweigt die menschlichen Schwächen der Wittgensteins keineswegs, und er verschweigt auch nicht die Kälte und die Herzlosigkeit, die zwischen den Familienmitgliedern herrschte, die teilweise vollkommen den Kontakt untereinander abgebrochen hatten, und deren Stolz auch verhinderte, diesen Kontakt wieder aufzunehmen. Dass Waugh die Biographien der einzelnen Familienmitglieder chronologisch parallel führt und streckenweise kaum miteinander verbindet, ist daher verständlich, allerdings hätte man sich doch gewünscht, dass der Autor eine solche Verbindung knüpft.
Die Beschreibung des hartnäckigen Kampfes Paul Wittgensteins um Anerkennung seines Klavierspiels als einarmiger Pianist – Paul hatte im ersten Weltkrieg den rechten Arm verloren – bildet die beste Seite dieser ausführlichen und detailreichen Biographie der Wittgensteins. Waugh versteht es, nicht nur die musikalische Bedeutung und das Ringen um Anerkennung des Pianisten zugänglich zu machen, sondern beschreibt auch packend die zähen und konfliktreichen Auseinandersetzungen Paul Wittgensteins mit Konzertagenten und vor allem jenen Komponisten, die für ihn und von ihm in Auftrag gegebene Klavierstücke für einen Arm komponierten. Darunter sind nicht nur Komponisten zu finden, die heute nur mehr Spezialistinnen und Spezialisten bekannt sind (wie Josef Labor oder Franz Schmidt), sondern beispielsweise auch Maurice Ravel, Sergej Prokofjew oder Benjamin Britten. Waugh gelingt es jedoch nicht so recht, die Lebenswege der Mitglieder der bekannten Familie zu kontextualisieren, zu sehr bleibt das Buch an der Oberfläche der Ereignisse. Waugh vermag es zwar, die geistige und gesellschaftspolitische Atmosphäre des gesamten 20. Jahrhunderts vor dem geistigen Auge der Leserinnen und Leser zu evozieren, aber nur dann, wenn man als Leserin oder Leser die kulturelle und gesellschaftspolitische Entwicklung dieses Jahrhundert bereits kennt.
Dem Autor gebührt für seine ausführliche Recherchearbeit – hilfreich ist im Übrigen der Stammbaum der Wittgensteins am Anfang des Buches, der ausführliche Anmerkungsapparat sowie das Register – und für die streckenweise spannende Erzählweise großen Respekt. Gerade weil Leserinnen und Leser vieles aus dem Leben der Familienmitglieder und anderer Protagonistinnen und Protagonisten erfahren, ist es schade, dass Handlungsmotive und (emotionale) Konsequenzen unterbelichtet bleiben: Warum ist Paul der musikalische Erfolg so wichtig? Warum verhalten sich die Wittgensteins in der beschriebenen Art und Weise? Warum die Kriegsbegeisterung bei Ausbruch des Ersten Weltkrieges? Was bedeutet es für eine Familie, wenn drei von fünf Brüdern Selbstmord begehen? Warum ist Ludwig plötzlich von Tolstoi und religiösen Themen so begeistert? Usw. Der Autor ist leider nicht imstande, viele unklare und unpräzise Stellen aufzuklären. Ähnliches gilt bei der Beschreibung politischer Ereignisse, die blass und oberflächlich bleibt. Zwei kleine Beispiele mögen genügen: Den Ersten Weltkrieg auf „ein phänomenales Getümmel von Nationen, die im Namen der Ehre in Aktion traten“ (94), zu reduzieren, ist ebenso nichtssagend wie es irreführend ist, Kaiser Karl I. als Regent zu beschreiben, der nur den Frieden wollte. Waugh läuft Gefahr, bezüglich geschichtlicher Ereignisse einigen – durchaus populären – Mythen und Irrtümern aufzusitzen. Dass man kaum Neues zu Ludwig Wittgenstein erfährt, fällt im Vergleich dazu weniger ins Gewicht: Es wäre auch zu viel verlangt und wohl auch nicht sinnvoll (vor allem angesichts der ohnehin verfügbaren Literatur), dies zu leisten; allerdings würde man sich doch wünschen, dass das, was beschrieben wird, in seiner Bedeutung zugänglich gemacht wird: Der Bau des berühmten Hauses in der Kundmanngasse in den 1920er Jahren – um nur ein Beispiel zu erwähnen – erscheint als Spinnerei eines ‚wahnsinnigen Genies‘, aber dessen architektonische Bedeutung wird nicht gewürdigt, ebenso wenig die Tatsache, dass es häufig Spinnereien von Genies sind, die Bahnbrechendes in Kunst und Kultur hervorzubringen vermögen.
Ärgerlich sind die unnötigen Wiederholungen und vor allem die zahlreichen kitschig wirkenden, klischeehaften und dramatisierenden Stellen, was unter anderem am Stil des Autors (und vielleicht auch an der Übersetzung) liegt. Auch hier mögen einige Beispiele unter (leider recht) vielen genügen: „Es war ein windiger Tag. Auf dem Dach der Kirche schimmerten die farbigen Ziegel wie die Schuppen eines exotischen Fisches, und über dem Hauptportal […] sah das tückische Gesicht eines Juden in seinem pileum cornutum auf Hermann und seine Gäste herab […].“ (S. 32/33) Über Hermine Wittgenstein erfahren wir, dass keiner der „Verehrer […] hartnäckig und leidenschaftlich genug gewesen [war], um aus der Jungfrau eine Ehefrau zu machen“ oder dass sie „[i]n ihren letzten Jahren […] einem gutaussehenden Offizier in Frühpension [ähnelte]“ (S. 23). Über Leopoldine Wittgenstein heißt es: „Sie war klein, hatte ein rundes Gesicht mit langer Nase“, und „[a]ls Erwachsene litt sie unter regelmäßig wiederkehrenden Migräneattacken und Venenentzündungen in den Beinen“ (S. 59). (Wollten wir das so genau wissen?) Lady Ottoline Morrell wird uns als Bertrand Russells „pferdegesichtige Geliebte“ vorgestellt (S. 74), und über die Rezeption des schwer verständlichen „Tractatus“ Ludwig Wittgensteins erfahren wir: „Tausende Bücher sind seither verfasst worden, um den Tractatus zu erklären, und keines gleicht dem anderen.“ (S. 200) Tja, was soll man da noch machen?
Bei einigen Stellen ist schlicht unverständlich, worauf Waugh abzielte – und hier können keine stilistischen Mängel mehr als Ursache ins Spiel gebracht werden –, etwa dann, wenn er (nahezu völlig unmotiviert) Hitler ins Spiel bringt (und sogar ohne rechten Zusammenhang aus „Mein Kampf“ zitiert). So heißt es etwa: „Zu Hause in Urfahr, einem Vorort von Linz, wartete auf Hitler eine Mutter, die ihren Sohn im blinden Vertrauen auf seine Fähigkeiten verhätschelte. Die Familie Wittgenstein in Wien hingegen zollte den Talenten ihrer beiden jüngsten Mitglieder [Paul und Ludwig] nur zögernd Anerkennung.“ (S. 54) Hier, wie an einigen anderen Stellen auch, liegt einem die uralte Schülerfrage auf der Zunge: „Was wollte der Autor uns damit sagen?“ Dass nur aus verwöhnten Kindern Diktatoren werden? Dass man Kinder ja nur nicht loben darf, wenn man Genies hervorbringen will?? (Dass Waugh nicht mit Hitler sympathisiert, ist völlig klar, unklar bleibt trotzdem, was er mit der zitierten Stelle – und ähnlichen mehr – zum Ausdruck bringen möchte.)
Hier hätte man dem Autor und dem renommierten Fischer-Verlag einen besseren Lektor gewünscht. Trotz zahlreicher spannender Passagen bleibt also doch ein etwas schales Gefühl zurück: Bei einer solch packenden Familiengeschichte wäre doch mehr möglich gewesen.