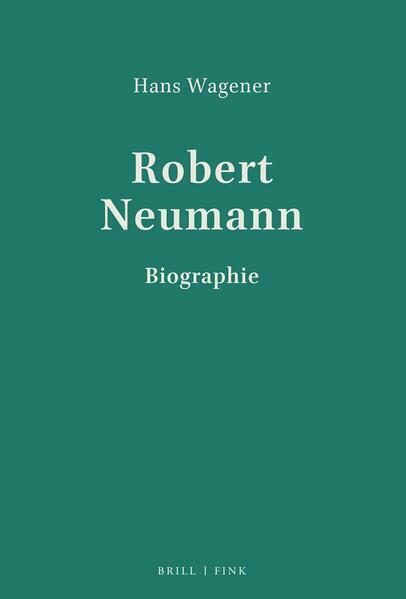Dass Hans Wagener in seiner nun erschienenen Biografie über den 1897 in Wien geborenen Robert Neumann kein Drehbuch dazu liefert, mag man einerseits bedauern, andererseits auch schätzen. Der Germanist an der University of California reiht nicht Anekdote an Abenteuer, sondern stellt den Autor und das Werk in einen literaturhistorischen Kontext. Diese Vorgangsweise geht natürlich auf Kosten der Lebendigkeit, hat aber den Vorzug der Nüchternheit. Anders als Neumann, der in seiner Biografie über „Sir Basil Zaharoff“ (1934) den in England geadelten Waffenschieber „zu dämonischer Dimension inflationierte“, wie er sich selbst ausdrückte, bleibt Wagener bei den Fakten. Neumann zog in seinem Band über den „König der Waffen“ alle Register seiner Lebens- und Schreiberfahrung, um Zaharoff als Hochstapler und Fälscher großen Stils darzustellen, der skrupellos über Leichen ging. Wagener dagegen spielt Neumanns Größenwahn und Streitsucht eher herunter. Beides waren jedoch lebensbestimmende Eigenschaften, ohne die Neumann letztlich auch nicht zu seinem Ruhm als Parodist gekommen wäre.
Zum Beruf des Parodisten gehört nämlich, wie er selbst behauptete, eine „Entschlossenheit, nicht zu verulken, sondern ins Herz zu treffen“, gepaart mit einer „hochstaplerischen Begabung“. Von beidem hatte Neumann reichlich. Und trotzdem war es keinerlei „Lebensplanung“, die aus ihm einen bekannten Autor machte, sondern einer jener berühmten Wechselfälle des Lebens. Nachdem er Mitte der 1920er-Jahre als Geschäftsmann gründlich gescheitert war, nicht mehr wusste, wie er Frau und Sohn ernähren sollte, schickte er an die Wiener Wochenzeitung „Die Bühne“ ein paar Parodien, die er in den Jahren davor so nebenbei geschrieben hatte. Ein paar davon wurden auch tatsächlich abgedruckt, sodass Neumann sich ermuntert fühlen konnte, ein Bändchen zusammenzustellen und dieses Verlagen anzubieten. Zunächst – und das waren immerhin drei Jahre – erfolglos. Erst als er von einer abenteuerlichen Schiffsreise an den Bosporus, bei der er Zaharoff kennengelernt hatte, zurückkam, sah er ein Exemplar im Schaufenster einer Buchhandlung. Sein Freund Ernst Lissauer, ein deutschnationaler Jude, der 1914 mit seinem „Hassgesang gegen England“ traurige Berühmtheit erlangt hatte, die er nie mehr los wurde, obwohl er längst zum Pazifisten geworden war, hatte Adolf Spemann, den Eigentümer des Engelhorn Verlags, dazu gebracht, das Buch 1927 zu veröffentlichen. Für Robert Neumann bedeutete es den Durchbruch, auch wenn einige (wenige) Literaten „not amused“ waren, in diesem Band vorzukommen. Die Kritiker und das Publikum waren durchwegs begeistert, weshalb die Auflage von 5000 Stück noch vor Ende des Jahres ausverkauft war.
Hätte Hans Wagener eine populäre Biografie schreiben wollen, so hätte er das eine oder andere Zitat aus den Parodien über Bert Brecht, Thomas Mann, Rainer Maria Rilke, Franz Werfel oder anderen inzwischen in die Weltliteratur eingeschriebenen Dichtern eingestreut. Wagener dagegen bleibt literaturwissenschaftlich und berichtet, dass Neumanns Parodien von Heinz Dietrich Kerner in der Zeitschrift „Die Literatur“ zur neuen Form der Literaturkritik stilisiert wurden: „Packt ihn (den Literaten, Anm.) im Kern seiner Persönlichkeit, da wo Eitelkeit Unvermögen, Dünkel und Geschwätzigkeit das Talent bestimmen oder bedrohen, packt ihn gerade da, wo die von Literaturkennern so gepriesenen, ‚individuellen Züge‘ rettungslos ins Tragikomische hinübergleiten.“ Es gehört aber nicht nur Boshaftigkeit dazu, um so witzige und treffende Parodien vorzulegen, wie Neumann das mit den Bänden „Mit fremden Federn“ (1927) und „Unter falscher Flagge“ (1932) getan hat, sondern auch Einfühlungsvermögen. Gerade dieses, so scheint es, hat ihm seine Feinde eingetragen, weil sie sich demaskiert fühlten.
Bevor Robert Neumann nach der Niederlage der Sozialdemokratie in den blutigen Kämpfen vom Februar 1934 Österreich verließ, war er zu einem der erfolgreichsten Autoren der Ersten Republik aufgestiegen. Sein Roman „Sintflut“ von 1929 wurde in mehrere Sprachen übersetzt und geriet zu seinem ersten großen internationalen Erfolg. Das änderte sich, als die Nazis in Deutschland die Macht ergriffen. Zufällig hielt sich Neumann am 30. Jänner 1933 in Berlin auf und sagte einem Reporter der „Neuen Freien Presse“, kurz bevor Hitler zum Kanzler ernannt wurde, dass es mit diesem „jetzt aus“ sei. Ein paar Monate danach befand sich auch Neumanns Name auf der Liste jener Autoren, deren Bücher am 10. Mai 1933 verbrannt wurden. Da traf es sich gut, dass er im Sommer aus London das Angebot bekam, eine Biografie über den Waffenhändler Zaharoff zu schreiben.
Dass damit der leidvollste Abschnitt von Neumanns Leben begann, sieht auch der Biograf Hans Wagener so, verwickelt sich am Beginn des Kapitels über das Exil aber in Widersprüche, nicht nur was die Motivation Neumanns anbelangt, nach London zu gehen, sondern auch in punkto Zeitpunkt der Emigration der Familie: Spricht er eingangs noch davon, dass Neumann Frau und Kind „noch im selben Jahr“ nach London holte, so berichtet er eine Seite später, dass Neumann „bis kurz vor dem ,Anschluss mehrmals wieder in Wien“ war, „um seine Frau und seinen Sohn Heini zu besuchen“. Klar ist, dass Neumann bis zum Einmarsch der Hitlertruppen noch etliche Monate in Österreich verbracht hat. Und sein Wechsel an die Themse hatte mindestens so viel private wie politische Gründe. Hatte er doch 1933 seine spätere zweite Frau Franziska Becker, genannt Rolly, kennengelernt und in der Folge jahrelang eine Ménage-à-trois unterhalten, die seine erste Frau nervlich völlig zerrüttete. Insgesamt sollten es in Neumanns Leben vier Ehefrauen werden, von den Affären dazwischen nicht zu reden.
Zweifellos hat der routinierte Biograf Wagener, der bereits über Lion Feuchtwanger, Richard Friedenthal, Erich Kästner, Sarah Kirsch, Siegfried Lenz, Gabriele Wohmann, Carl Zuckmayer und andere gearbeitet hat, ausgiebiges Quellenstudium betrieben. Dass er sich trotzdem in ein paar Widersprüche verwickelt, etwa auch über die finanzielle Situation Neumanns, hat wohl damit zu tun, dass er sich zu stark auf die beiden Autobiografien Neumanns, „Ein leichtes Leben“ (Desch, 1963) und „Vielleicht das Heitere“ (Desch, 1968), verlässt. Wobei letztere eine fiktionalisierte Autobiografie ist, da Neumann dieses Buch seinen 1944 verstorbenen Sohn schreiben lässt. Dessen Tod war für Neumann der Höhepunkt der Leidensphase seines Lebens, die mit der Installation des Austrofaschismus in Österreich begonnen hatte.
Dass Neumann zeitlebens Antifaschist war, ist unbestritten, auch, dass er links stand. Viel weniger eindeutig und somit auch seinen Biografen überfordernd ist, wo genau Neumann politisch anzusiedeln ist. Dabei tut sich Wagener insofern schwer, als Neumanns Lust, sich „bis in die Hoch- und Nachreife hinein mit neuen Feinden zu versorgen“, wie ein Rezensent schrieb, keinerlei ideologische Grenzen kannte. Wer will einen Mann politisch einordnen, der sich von Alfred Andersch über Hans Habe, Erika Mann und Carl Zuckmayer bis zur gesamten Gruppe 47 mit allen anlegte und sogar seinen eigenen, den PEN-Club gegen sich aufbrachte. Seine Bissigkeit hat möglicherweise auch damit zu tun, dass er nach seiner Rückkehr auf den Kontinent im Sommer 1959, zirka ein halbes Jahr nach dem Tod seiner dritten Frau Evelyn, als Schriftsteller nicht mehr an seine Erfolge vor dem Krieg anschließen konnte. Seine Art zu erzählen war passé, und umso lieber legte er sich mit jenen an, die jetzt das Feuilleton beherrschten.
In einigen kulturpolitischen Auseinandersetzungen in der Zweiten Republik spielte Neumann eine schwer durchschaubare Rolle. Dass er sowohl bei der Wiedererrichtung des österreichischen PEN-Clubs als auch bei der Abspaltung der Grazer Autorenversammlung (GAV) ein doppeltes Spiel spielte, kann man nicht zuletzt in Hilde Spiels autobiografischen Büchern nachlesen. Tendenziell unterstützte Neumann während des Kalten Kriegs die Sache der Kommunisten und attestierte etwa seinem langjährigen Freund Friedrich Torberg, „zu jedem Frühstück einen Kommunisten wie andere Leute ein weiches Ei“ zu verspeisen. Andererseits entzog er sich stets den Avancen, die ihm seitens der österreichischen Kommunisten gemacht wurden. Was bleibt also von Robert Neumann? Dass von seinem schriftstellerischen Werk nur noch der Roman „An den Wassern von Babylon“ lieferbar ist, wird seiner literarischen Bedeutung sicher nicht gerecht. Es ist nur recht und billig, dass der Eichborn Verlag jetzt den Nachkriegsroman „Die Kinder von Wien“ neu auflegt. Die vorliegende Biografie kann jedoch nur bedingt dazu beitragen, Robert Neumann wieder ins Bewusstsein eines literaturinteressierten Publikums zu rufen. Dazu ist sie zu fachspezifisch als auch kompositorisch zu wenig ambitioniert geraten. Neumanns Rolle als Literaturfunktionär wäre sicher eine eigene Untersuchung wert. Für die Republik Österreich ist es jedenfalls eine Schande, dass sie den 1975 durch eigene Hand ums Leben gekommen Exilanten Neumann weder zur Rückkehr eingeladen noch ihm irgendeinen Preis zuerkannt hat.