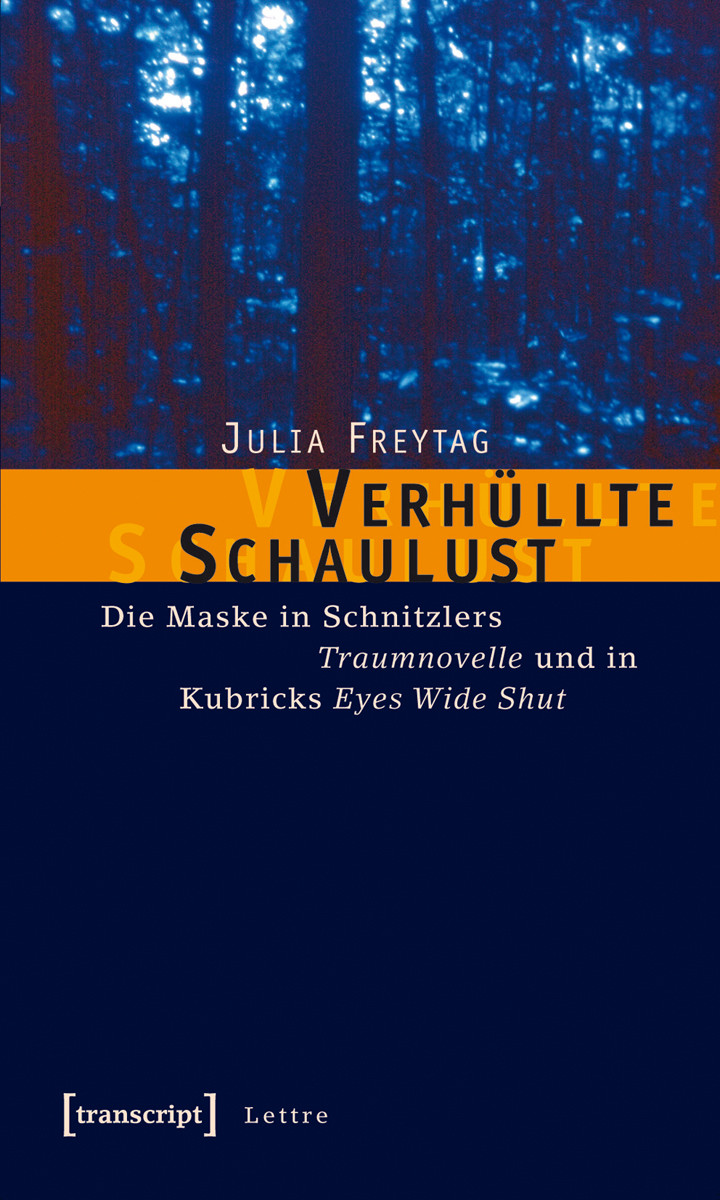Fridolin ist über diese unzensierten Wunschträume seiner Frau tief schockiert, und sucht nun seinerseits nach Erlebnissen, durch die er mit ihren Sehnsüchten Schritt halten könnte. Was Albertine in der Phantasie und im Traum glückt, misslingt ihm allerdings, nicht zuletzt deshalb, weil er sich die Wirklichkeit als Schauplatz seiner Wünscherfüllungen aussucht: Er taumelt im nächtlichen Wien von einer erotisch aufgeladenen Situation in die nächste, lässt sich jedoch mit keiner der Verlockungen körperlich ein, sondern bleibt in allen Situationen der innerlich erregte, aber äußerlich distanzierte Zuschauer. Was führt dazu, dass diese „unsinnige Nacht mit ihren läppischen, abgebrochenen Abenteuern“ („Traumnovelle“) seine Sehnsucht nicht befriedigen kann. Am darauf folgenden Tag versucht er, den Rätselbildern der Nacht nachträglich einen Sinn zu geben, doch gelingt auch das nur rudimentär.
Julia Freytags Studie Verhüllte Schaulust bietet eine plausible Deutung dieses Novellengeschehens an: Ausgehend von Léon Wurmsers psychoanalytischem Standardwerk „Die Maske der Scham“, versteht sie Fridolins vergeblichen Ausbruchsversuch als Ausdruck einer multiplen Beschämung: Gedemütigt von der Offenheit seiner Frau, versucht er sich an ihr zu rächen, kann aber im genauen Wortsinn nicht „aus sich herausgehen“. Während er nach Abenteuern sucht, die den Rahmen seiner bürgerlichen Existenz sprengen könnten, ist er zugleich darum bemüht, seinen respektablen Status als Arzt und seine sozusagen „anständige“ Position als Ehemann und Familienvater nicht zu gefährden. Das Ergebnis dieser Ambivalenz ist, Freytag zufolge, Fridolins spezifische Form der Schaulust: Weil er sich nicht berühren lassen will, beschränkt er sich aufs Sehen. Das ist einerseits schamlos, weil er auch dort noch hinblickt, wo „man“ anständigerweise wegzuschauen hätte, es ist aber andererseits verschämt: zum einen, weil sich Fridolin zwanghaft auf das Schauen beschränkt, und zum anderen, weil er großen Wert darauf legt, dabei nicht beobachtet zu werden. Unausgesetzt ist er damit beschäftigt, zu kontrollieren, ob die Augen und Blicke der anderen nicht auf ihn gerichtet sind
Hier nun gewinnt das Motiv der Maske, für das sich Julia Freytag im Besonderen interessiert, sein Gewicht. Wie der Autor beschreibt und die Wissenschaftlerin analysiert, verbirgt sich Fridolin hinter mehreren Masken: Als ihm das Fräulein Marianne am Totenbett ihres Vaters ein Liebesgeständnis macht, zieht er sich in die Rolle des besorgten Arztes zurück. Und weil er sich nicht entschließen kann, mit der Prostituierten, die er auf ihr Zimmer begleitet hat, auch zu schlafen, flüchtet er sich ins Fürsorgliche und nimmt sich vor, „dem lieben armen Ding morgen Wein und Näschereien heraufzuschicken“ („Traumnovelle“). Am Beginn jener rätselhaften Orgie, die das Geschehen der Nacht abschließt, ist es ihm dann möglich, aufreizend nackte, aber maskentragende Frauen zu bewundern, und dabei selbst durch eine Maske geschützt zu sein. Aber bevor er sich dieser doppelt „verhüllten Schaulust“ ganz und gar hingeben kann, wird er auch schon demaskiert – und damit wieder von jenem Gefühl der Beschämung eingeholt, das alle seine Eskapaden konterkariert.
Erfreulicherweise entwickelt Julia Freytag ihre Grundthese nicht so umweglos, wie es in der Zusammenfassung hier erscheinen mochte. Sie unterzieht Schnitzlers Text einer gründlichen Lektüre und zeigt dabei nicht nur die zentrale Bedeutung der Maske und der Scham auf. Sie analysiert etwa auch Schnitzlers subtile Lichtregie, die immer wieder dafür sorgt, dass sich der verschämt-unverschämte Voyeur im Dunkeln befindet, während die Objekte seiner Begierde in plötzlich auflammendem Licht in Erscheinung treten. Schließlich wird auch darauf hingewiesen, dass Fridolins scheinbare Seh-Erlebnisse im Grunde nur Wiederholungen früherer Eindrücke sind – was den Grundbefund bestätigt: Im Unterschied zu seiner Frau kann er seinen Hemmungen und Verschämtheiten nicht entkommen. Am ehesten gelingt ihm noch eine Art Hingabe, als er in der Morgue jene Tote anschaut, von der er glaubt, sie habe sich während der obskuren Orgie für ihn geopfert. Da verlässt ihn die Scheu, weil eine Leiche nicht mehr die Möglichkeit hat, den begehrlichen Blick zu erwidern.
Da Schnitzlers „Traumnovelle“ im Wesentlichen vom Sehen und Gesehenwerden handelt, hat sie hohe visuelle Qualitäten. Freytag erwähnt, dass der begeisterte Kinogeher Schnitzler selbst eine Verfilmung der „Traumnovelle“ ins Auge gefasst hatte und an Entwürfen für ein Drehbuch arbeitete. Doch kam der Stoff erst 1999 ins Kino: „Eyes Wide Shut“, Stanley Kubricks letzte Regiearbeit, ist keine simple Verfilmung von Schnitzlers Text und wird auch von Freytag nicht so verstanden. Sie fragt mit Recht nicht danach, wo Kubrick Schnitzler treu bleibt und wo er von ihm abweicht (das wären allzu biedere Philologensorgen). Stattdessen nimmt sie den Film so, wie er ist, und versteht ihn als Bearbeitung eines Psychodramas mit filmischen Mitteln. Das krisengefährdete Ehepaar lebt hier in New York und trägt die Namen Bill und Alice Harford. Die Ehefrau heißt also genauso wie Lewis Carrolls berühmte Kinderbuchfigur. Dies aber wohl nicht, weil sie sich nach einem „Wunderland“ sehnt, wie Freytag vermutet, sondern weil Carroll noch einen zweiten Alice-Band verfasst hat, der den Titel „Through the Looking Glass“ trägt: Darin gleitet Alice durch einen Spiegel hindurch, um dahinter bizarre Dinge zu erleben. Auf diese Geschichte wird in einer Szene von „Eyes Wide Shut“ überdeutlich angespielt: Die Kamera kommt hier dem Spiegel im Harfordschen Badezimmer immer näher, sodass der Zuschauer schließlich nur noch das Abbild der nackten Alice (samt Ehemann) sieht, und nicht mehr die Personen selbst. Freytag beschreibt diese Szene sehr genau, aber die nahe liegende Assoziation zu „Through the Looking Glass“ hat sie offenbar nicht erkannt – was zwar kein allzu großes Versäumnis ist, aber doch eine Nuance vernachlässigt, die dem englischsprachigen Publikum wahrscheinlich nicht entgangen ist.
Bedeutsamer als der räumlich-zeitliche Wechsel vom Fin-de-Siècle-Wien ins Jetztzeit-New York ist indes der mediale Wandel: Gewiss erlebt das amerikanische Kino-Ehepaar in allen psychologisch wesentlichen Zügen dasselbe wie Albertine und Fridolin in Wien. Aber aus der Novelle wurde ein Film, der von der Interpretin auch methodisch anders behandelt wird als der Text. Während Freytag die „Traumnovelle“ „immanent“ analysiert, nähert sie sich „Eyes Wide Shut“ rezeptionsästhetisch, d. h. sie bezieht die Wirkungen auf „den Zuschauer“ mit ein. Die Frage, wie „die Zuschauerin“ auf den Film reagierte, stellt sie dabei leider nicht. Aber sie zeigt sehr anschaulich, dass Kubrick sein Publikum zum Voyeur macht. Im ersten Bild des Filmes lässt Alice Harford alias Nicole Kidman ihr Kleid fallen und steht vollkommen nackt mit dem Rücken zur Kamera. Bevor der schaulustige Kinobesucher diesen Anblick aber noch recht genossen hat, wird die Leinwand dunkel, und der Schriftzug „Eyes Wide Shut“ erscheint. Freytag meint zu diesem provokanten Auftakt: „Diese Enthüllung inszeniert den voyeuristischen Blick des Zuschauers, dem jedoch sogleich wieder die Augen geschlossen werden, indem er eine schwarze Leinwand sieht.“ (S. 92f) Auch im weiteren Verlauf des Films wird die Schaulust immer wieder gereizt, um dann umso gründlicher frustriert werden zu können. Dadurch hat der Zuschauer unmittelbar Anteil an dem Psychodrama, das Bill Harford alias Tom Cruise im Film erlebt. Das starre, maskenhafte Spiel, für das Cruise von vielen Kritikern getadelt wurde, wird von Freytag übrigens sehr überzeugend als gelungene schauspielerische Leistung gewürdigt: Auch Bill Harford trägt eben die Maske der Scham. So gesehen, ist der Titel des Films, „Eeys Wide Shut“, nichts anderes als eine Entsprechung zum Begriff „verhüllte Schaulust.“
Julia Freytags Durchgang durch Kubricks Film endet mit der derselben Szene wie ihre Lektüre der „Traumnovelle“: Bill, respektive Fridolin kommt erschöpft nach Hause zurück und findet Alice, respektive Albertine schlafend vor. Neben der Schlafenden liegt die Maske, die er während der Orgie getragen hatte. Er hat versäumt, sie dem Kostümverleiher zurückzubringen, und seine Frau hat sie gefunden. Angesichts dieser abgelegten Maske bricht Fridolin, bzw. Bill in Tränen aus, Albertine oder Alice erwacht, und der Mann beginnt damit, seine Erlebnisse zu erzählen. Freytag bezweifelt in beiden Fällen, dass durch diese Erzählung die Wahrheit über das männliche Innenleben ans Licht kommen werde: Im Falle Fridolins unterstellt sie, der äußeren Demaskierung werde wohl keine wahrhaftige innere folgen (vgl. S. 77) , und Bill Harfords Tränen werden als Eingeständnis einer Niederlage interpretiert. Er sei, meint Freytag, „gescheitert an seinem uneinlösbaren Begehren, das Verborgene zu sehen. Denn die Maske bleibt undurchdringlich oder verbirgt nur weitere Masken“ (S. 125).
Das mag ja sein. Aber als einziger ernsthafter Einwand gegen Julia Freytags bedenkenswerte Studie muss doch vermerkt werden, dass weder die Novelle noch der Film mit der Szene enden, die Freytag zum resignativen Schluss des Ganzen erklärt. Stattdessen folgt dieser Szene noch die wirklich letzte, die am nächsten Tag spielt: Das Ehepaar ist sich durch all die Irritationen über seine Fragwürdigkeiten klar geworden und es beschließt, gemeinsam weiter zu leben – klüger als zuvor, abgeklärter, sozusagen mit eyes wide open. An dieses optimistische happy end braucht man nicht unbedingt zu glauben, aber man sollte es über dem Interesse an den Nachtseiten der Seele nicht völlig ignorieren. Denn immerhin haben sowohl Arthur Schnitzler als auch Stanley Kubrick daran festgehalten.