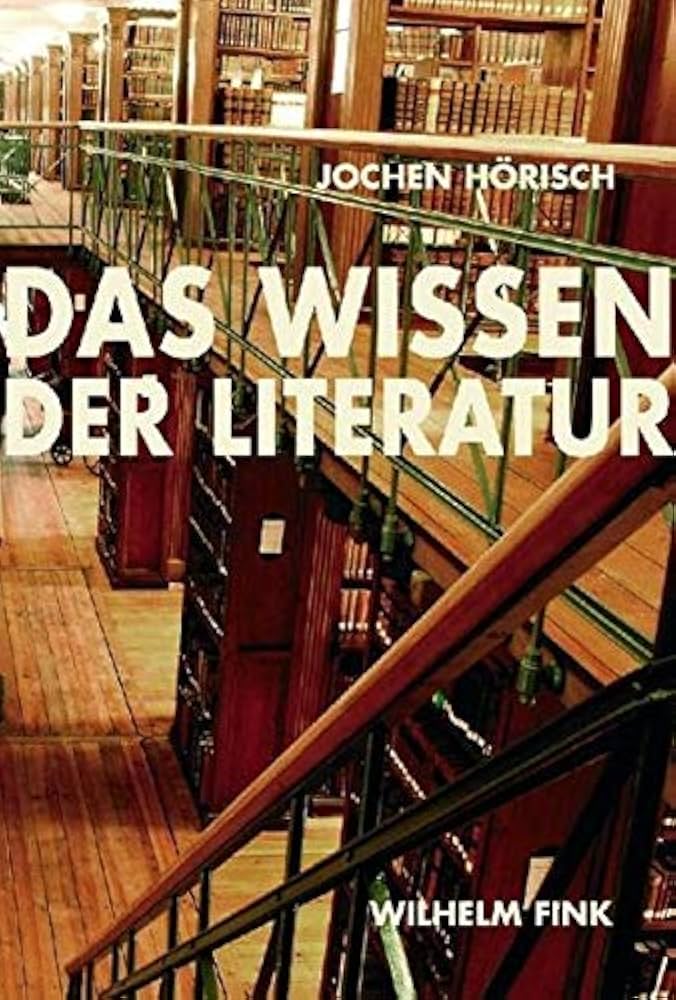Die dritte Variante ist die poetische, die nicht von Hörisch stammt, sondern von Schiller:
Wem der große Wurf gelungen
Eines Freundes Freund zu sein;
Wer ein holdes Weib errungen
Mische seinen Jubel ein!
Ja – wer auch nur eine Seele
Sein nennt auf dem Erdenrund!
Und wers nie gekonnt, der stehle
Weinend sich aus diesem Bund.“
(Vgl. S. 159)
An diesen bekannten Vers schließt der Literaturwissenschaftler dann ausführliche Erwägungen darüber an, dass die Klassiker und Romantiker zwischen (gleichgeschlechtlicher) „Freundschaft“ und (heterosexueller) „Liebe“ nicht so streng kategorisch unterschieden haben, wie das später meist der Fall gewesen ist. Das „holde Weib“ und der „Freund“ werden von Schiller mit derselben emotionalen Anteilnahme bedacht: Die eine wie der andere ist ein „großer Wurf“.
An diesem einen Beispiel zeigt sich schon die Problematik, die Hörisch untersucht: Literarische Texte, die meist dem anerkannten Kanon der deutschen Literaturgeschichte angehören, werden nach ihren spezifischen Wissensinhalten untersucht. Weil aber jede literaturwissenschaftliche Arbeit ihre Trademark braucht, bezeichnet Hörisch seine Forschungen als „problem- und themenzentrierte Literaturwissenschaft“. Was, so fragt also der themenzentrierte Forscher, weiß die Literatur über Liebe und Freundschaft, was weiß sie über das Kranksein, was über das Verhältnis von Sprache und Recht, was über die Zeit, das Schlafen, das Vergessen, das Erinnern? Allerdings wären die Antworten auf diese (und manche andere) Fragen von bloß kulturhistorischem Interesse, wenn Hörisch nicht doch ein Bewusstsein von den formalen Besonderheiten des Mediums Literatur hätte. Er aber zeigt auch, dass es für die jeweiligen Wissensinhalte nicht gleichgültig ist, in welcher Form sie dargestellt werden. Um beim eingangs zitierten Beispiel zu bleiben: Schillers Dithyrambe mag zwar denselben Inhalt haben wie die beiden prosaischen Paraphrasen, ihre spezifische Qualität und Bedeutung gewinnt sie aber nur durch Reimschema, Metrum und Rhythmus.
Es gehört zu den Qualitäten des Buchs, dass die Spezifik der literarischen Wissensvermittlung niemals außer Acht gelassen wird. In immer neuen Anläufen unternimmt Hörisch den Versuch, die Besonderheiten des poetischen Wissens von anderen Wissensformen abzugrenzen. Deshalb fragt er zum Beispiel im Kapitel über die Krankheit nicht nur danach, welche medizinischen Kenntnisse sich in der Literatur niedergeschlagen haben, sondern er untersucht ebenso, welches Literaturverständnis dazu führte, dass manche Krankheiten – etwa die Tuberkulose oder der Aussatz – hochgradig „literatur-tauglich“ werden konnten, während sich andere Übel offenbar weniger gut zur literarischen Gestaltung eigneten.
Durch Erwägungen dieser Art macht Hörisch klar, dass die Literatur zwar jede Art von Wissensstoff enthalten kann, dass aber ihre spezifisch ästhetische Qualität von der Zuverlässigkeit dieses Wissens nicht abhängig ist. Ein literarisches Werk kann voll falscher Sach- oder Werturteile sein und dennoch aufs Eindrucksvollste poetisch gelingen. Diese Tatsache war, wie auch Hörisch weiß, schon den antiken Philosophen bewusst, und sie wurde seitdem immer wieder in unterschiedlichen Bewertungen diskutiert. Im Lauf dieser jahrhundertelangen Diskussion zeigte sich dann immer wieder erneut, dass die Dichtung einen anderen logischen Status hat als die Wissenschaft oder das Alltagswissen. Weil das so ist, hat es wenig Sinn, die sachliche Richtigkeit eines Gedichts oder eines Romans einzuklagen – denn, so Hörisch: „Schöne Literatur hat einen binären Leitcode, der sich entschieden von dem der Wissenschaften abgrenzt. Er lautet nicht wahr/ falsch, sondern stimmig/ nicht-stimmig. Soll heißen: gerade weil die epistemische Grundorientierung von Literatur eine andere ist als die der Wissenschaften, kann Literatur erfolgreich ein Spiel spielen, das da heißt: Ich seh etwas, was du nicht siehst.“ Gegen diesen Befund, der die Rückseite des ansprechend gestalteten Buches schmückt, ist eigentlich wenig einzuwenden.
1990 hat Heinz Schlaffer das spannungsreiche Wechselspiel zwischen (fiktionenbildender) Dichtung und (faktenschaffender) Erkenntnis in seinem Buch „Poesie und Wissen“ eindringlich analysiert (erschienen bei Suhrkamp). Hörisch knüpft an diese grundlegende Abhandlung ausdrücklich an und denkt sie in unterschiedlichen Formen weiter. Dabei geht es allerdings nicht so konzentriert und prägnant zu wie in Schlaffers Standardwerk. Das liegt wohl vor allem daran, dass es sich hier nicht um ein Buch aus einem Guss handelt, sondern um eine Zusammenstellung älterer Aufsätze, die unter dem Passepartout-Titel Das Wissen der Literatur neu aufgelegt wurden. Aber so weiträumig diese Formel auch ist – Hörisch schafft es dennoch, einen Aufsatz in seinem Buch unterzubringen, der mit dem „Wissen der Literatur“ ganz und gar nichts zu tun hat. Stattdessen wird darin die Frage gestellt: „(Wie) passen Justiz und Massenmedien zusammen?“ Das ist zwar auch nicht uninteressant, gehört aber genau besehen in ein anderes Buch.
Von dieser Themenverfehlung abgesehen, bleibt Hörisch zwar bei der Sache, formuliert aber in vielen Teilen redundant (eine Reihe von Argumenten und Formulierungen taucht in fast identischer Form in mehreren Kapiteln auf). Außerdem zeigt sich leider immer wieder, dass philologische Sorgfalt nicht zu den Stärken dieses Germanisten gehört. Goethes berühmtes Drama zitiert er in der Fußnote auf S. 154 als „Tasso“, obwohl der exakte Titel „Torquato Tasso“ heißt. Das ist eine Kleinigkeit, die aber stört, zumal sich noch bedenklichere Nachlässigkeiten finden lassen. Wer wie Hörisch zwei Abhandlungen über die „Winterreise“ von Wilhelm Müller und Franz Schubert in sein Buch aufnimmt, sollte die Texte dieses berühmten Liederzyklus präsent haben. Aber auch da zeigt der Autor bemerkenswerte Schwächen. Das Lied „Zwielicht“, das er der „Winterreise“ zuschreibt (vgl. S. 186), gibt es zwar in Schumanns Eichendorff-Liederkreis, bei Müller und Schubert hingegen ist von einem „Irrlicht“ die Rede. Aus den „gefrornen Tropfen“, die in der ersten Zeile des dritten Liedes von den Wangen des Sängers fallen, macht Hörisch „gefrorne Tränen“ (S. 204), was dem Sinne nach natürlich stimmt, dem Wortlaut aber eben nicht entspricht. Schließlich liest es sich fast wie eine Satire, wenn es heißt: „Das Lied Die Krähe ist einem Pathos der Verzweiflung verpflichtet, das sich nach ‚Treue bis zum Graben‘ sehnt“ (S. 213). Ein „n“ weniger hätte diesem Satz sehr gut getan.
Solche Mängellisten haben immer einen etwas beckmesserischen Charakter, und tatsächlich wird ja die gedankliche Qualität eines Buches durch den einen oder anderen Druckfehler („Pivatal“ statt „Pitaval“, S. 102) nicht entwertet. Dennoch tragen diese kleinen Schönheitsfehler zu dem Eindruck bei, das Buch sei nicht sehr sorgfältig gearbeitet.
Was sich im Kleinen andeutet, bestätigt sich im Großen. Jochen Hörisch gehört zu den Literaturwissenschaftlern, die sowohl in den akademischen Innenwelten beachtet werden möchten als auch von der interessierten, nicht-wissenschaftlichen Öffentlichkeit. Um dieser durchaus lobenswerten Absicht zu entsprechen, bleibt er einerseits sehr nahe an den Inhalten der literarischen Texte – „themenzentriert“, wie gesagt – versucht aber andererseits auch, das Niveau der avancierten Literaturtheorie nicht zu unterbieten. Diese doppelte Anstrengung führt nicht immer zu erfreulichen Ergebnissen: Während Hörisch in seinen besten Momenten mit unterschiedlichen Sprachniveaus spielt (wie die Romantiker, deren ironischer Sprachphilosophie auch ein Aufsatz des Buches gewidmet ist), verliert er in schlechteren Augenblicken die Kontrolle über die Diskursmischungen. Wäre er ein Dichter, könnte durch diesen Kontrollverlust eine Écriture automatique entstehen, die sich in schöner Sinnlosigkeit austobt. Da Hörisch aber Wissenschaftler ist, gehorchen seine Sätze einer anderen „epistemischen Grundorientierung“, wie er selbst es nennen würde. Und deshalb darf man schon bezweifeln, ob etwa der folgende vollmundige Absatz über Goethes „Torquato Tasso“ wirklich so viel wert ist, wie er vorgibt: „Eine eminent moderne Figur ist Tasso, weil er das erfährt, was Systemtheoretiker heute gerne modisch ‚tragic choice‘ nennen und was doch zum besten Traditionsbestand der Dramenliteratur gehört. Der Glaube an die Kraft der Kommunikation ist falsch – und ohne Alternative. Denn Sprache ist zugleich ein Medium der Lüge und der Wahrheit, der Kränkung und der Heilung, der Herrschaft und der Befreiung – selbst vom falschen Glauben an den Fetisch Kommunikation und Konsens.“ (S. 157.)
Wer unbedingt will, kann schon der Meinung sein, dass an dieser Mischung aus Systemtheorie und Tragik „etwas dran“ ist. Wer aber in diesen Sätzen vor allem das Klappern theorielastiger Phrasen vernimmt, hat irgendwie auch nicht Unrecht. Und da es in dem Buch viel zu viele Sätze dieser Art gibt, lässt sich als Fazit sagen, dass „Das Wissen der Literatur“ zwar im Großen Ganzen gut gedacht, aber in vielen Details schlecht gemacht ist.