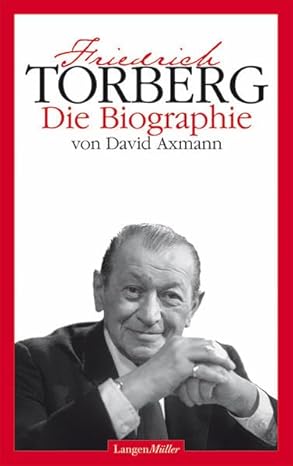Aber der erste Teil des Buches hat deutliche schriftstellerische Schwächen: Axmanns Ausführungen zur Kulturgeschichte, die Torbergs Entwicklung punktuell begleiten, sind oft sehr konventionell, mitunter gar banal und oftmals gelesen – à la „Wien um 1900“; der Abschnitt zur „Kaffeehausliteratur“ enthält sämtliche erwartbaren Klischees und beginnt mit einem halbseitigen, sattsam bekannten Zitat aus Zweigs „Welt von gestern“. Begriffliche Undeutlichkeiten säumen den Lebensweg: Im Hause Torberg habe eine „ideale“ Eltern-Kind-Beziehung geherrscht, Axmann führt aber nicht aus, was das „Ideale“ dieser Beziehung gewesen ist; Torberg wird mitunter als „Dichter“ bezeichnet, wobei man sich vorstellen kann, dass er selbst sich in dieser Zuschreibung nicht wohlgefühlt hätte; bei Axmann agiert das Ständestaat-Regime in „halbfaschistischer Manier“; an manchen Stellen wird nicht sauber zitiert, sondern werden Wörter aus Quellen übernommen, ohne sie als Zitat auszuweisen; an anderen wiederum klärt der Autor seine Position als Erzähler nicht ab: Wenn da steht „es ist zum Verzweifeln“, wird nicht klar, ob er Torberg paraphrasiert oder selbst am Verzweifeln ist.
Die größte Schwäche der ersten Hälfte der Biographie sind aber die überlangen Zitate, die sich teilweise über eine Seite und mehr erstrecken. Damit agiert Axmann einfach zu nahe an Torberg, man hat den Eindruck, nur das Wort des Meister gilt. Phasenweise wird das Buch zu einer Zitat-Montage mit nur ein, zwei Sätzen des Autors dazwischen – diese fehlenden Übergänge, wenn etwa ansatzlos von Alfred Adler zu Karl Kraus gewechselt wird, sind unelegant, wirken unbeholfen. Besonders wenn die langen Zitate aus ohnehin greifbaren Büchern wie „Die Erben der Tante Jolesch“ stammen, werden solche Passagen ein wenig enervierend. Zudem wird durch häufiges und ausführliches Zitieren Axmanns Hauptquelle allzu deutlich: die Korrespondenz Torbergs mit seiner Schwester (Axmann ist als Nachlassverwalter im Besitz dieser Dokumente). Solche Unausgewogenheiten und Mängel verhindern nicht, dass man inhaltlich der reichen und vielfältigen Lebensgeschichte gerne folgt. Da gibt es so schöne Details wie etwa die Auswahl der Gegend seiner Untermietzimmer „in Hinblick auf nächtliche oder frühmorgendliche Gesprächserlebnismöglichkeiten“, „er suchte Logis in der Nähe der Wohnungen jener Männer, die er vom Café Herrenhof zu Fuß nach Hause begleiten durfte“.
Ab dem amerikanischen Exil, besonders aber nach Torbergs Rückkehr nach Österreich 1951 liest sich die Biographie teilweise wie ein anderes Buch, die Zitate sind zumeist wesentlich kürzer und ausgewogener. Axmann gelingt es gut, Torbergs Ringen mit dem permanenten Zeitmangel, mit seinem Gefühl, alle Einladungen annehmen zu müssen, mit den Schattenseiten seiner Vielseitigkeit, mit den gesundheitlichen Folgen dieses Raubbaus empathisch darzulegen. Was die Liebeleien Torbergs betrifft, hält sich Axmann wohltuend zurück, was den anderen Anteil an dem Spruch „er war kein Kostverächter“ betrifft, bringt er Torbergs Phäakentum auf den Punkt: „Die Liebe zum guten Essen war ein Leitmotiv seines Lebens.“
Leider bleibt aber auch der zweite Teil hinter seinen Möglichkeiten zurück: Es wird dem Leser zwar der Mensch Torberg, es werden ihm die Leistungen Torbergs vorgeführt, aber es fehlt eine Einordnung unter die Zeitgenossen und die Einordnung der Zeitgenossen, man hätte sich etwas mehr kritische Distanz und breit gestreutere Quellen gewünscht – gerade bei den beiden Hauptkritikpunkten der Torberg-Gegner. Bei der Frage der Einschätzung der Herzmanovsky-Orlando-Bearbeitungen fällt Axmann ins Pathos („Torberg hat die Welt – und die Literaturwissenschaft – mit Herzmanovsky bekannt gemacht. Die Welt hat Herzmanovsky in der Torberg-Bearbeitung kennengelernt und war entzückt“), übernimmt kommentarlos Torbergs Ästhetik (Herzmanovsky habe „gegen das herkömmliche Produktionsverfahren und die allseits gültigen Regeln der Kunst“ verstoßen) und betreibt Germanisten-Schelte. Bei Torbergs Haltung gegenüber dem Kommunismus und dem stets genannten „Brecht-Boykott“ macht Axmann zwar Torbergs Haltung nachvollziehbar, dem der Kommunismus eine „konkrete Lebensbedrohung“ gewesen sei, die Unterstützung durch die Amerikaner lässt er jedoch im Dunklen, er begnügt sich damit, dass Torberg vor Gericht Recht bekommen hat, kein „CIA-Agent“ zu sein (von den vielen anderen Prozessen hätte man auch gerne mehr erfahren).
Man liest die Biographie wegen der Neuheiten aus Torbergs Leben streckenweise sehr gerne, aber die Recherchelücken, die zu enge Auswahl der Quellen bei gleichzeitiger Überlänge der Zitate, die Banalität im Kulturgeschichtlichen, Axmanns krude Literaturästhetik (die GAV habe bei ihrer Gründung aus „eher sprachfernen Aktionisten“ bestanden) und sein stellenweise elitaristischer Gestus (bei der uneleganten Germanistenschelte oder der „Generosität“ den Diplom- und Doktorarbeiten über Torberg gegenüber: „durchaus akzeptables Niveau“) verhindern, dass man dem bestimmten Artikel im Untertitel folgen mag und weiterhin auf die umfassende, kritische Biographie (die auch jene von Frank Tichy aus dem Jahre 1995 nicht war) zu Friedrich Torberg warten muss.