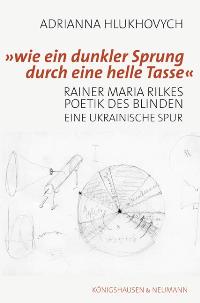„Das Lied von der Gerechtigkeit“ ist eine von Rilkes „Geschichten vom lieben Gott“, die erstmals 1900 und dann in überarbeiteter Form 1904 erschienen sind. Dieser kindlich-fromm sein wollende Erzählungszyklus gehörte zu Rilkes erfolgreichsten Büchern. Von den ästhetisch anspruchvolleren Verehrern des Dichters wurde er meist etwas verschämt abgehandelt, weil ein gewisser Kitschverdacht nicht von der Hand zu weisen ist. Adrianna Hlukhovych findet jedoch in ihrer Rilke-Studie einen sehr interessanten Zugang zu dieser Erzählung. Sie stellt die Gestalt des Sängers Ostap in einen doppelten Kontext: Zum einen rekonstruiert sie Rilkes Beziehung zur Ukraine, die er im Jahr 1900 auf seiner zweiten Russlandreise besucht hat, zum anderen denkt sie darüber nach, was es bedeutet, dass der Sänger, der in Rilkes Text wie eine schwarze Gigantengestalt auftritt, blind ist. (Weil er nichts sieht, verdunkelt sich bei seinem Auftritt für die anderen Menschen der Raum.)
Die Gestalt des Sängers Ostap ist keine Erfindung Rilkes. Noch bis ins frühe 20. Jahrhundert hinein wanderten Musiker durch die Ukraine und unterhielten ihre Zuhörer mit patriotischen und religiösen Liedern. „Kobzari“ wurden diese bettelnden Wandermusiker genannt, und sie waren in der Regel blind. Wie Hlukhovych ausführt, gehörte das Dasein als Sänger zu den wenigen Berufschancen, die sich einem Blinden in der Ukraine boten – man war allgemein davon überzeugt, dass Menschen, die nichts sehen, gute Sänger sein müssten, weil sie über ein scharfes Gehör und ein präzises Gedächtnis verfügten. So kam es, dass blind Geborene oder durch Unfall Geblendete bei älteren Sängern regelrecht in die Lehre gingen, um den Beruf des Kobzars zu erlernen. Und der berühmteste aller Kobzari war eben jener Ostap, der mit vollem Namen Ostap Veresaj hieß und von 1803 bis 1890 gelebt hat. Rilke war mit Veresajs Leben und Wirken vertraut, weil er zur Vorbereitung seiner zweiten Russlandreise das Buch „La Russie épique: étude sur les chansons héroïques de la Russie“ gelesen hat, verfasst von Alfred Rambaud, erschienen 1876 in Paris. In dieser volkskundlichen Abhandlung fand Rilke auch eine französische Übersetzung von Veresajs berühmtestem Werk, dem „Lied von der Gerechtigkeit“, das er sehr frei ins Deutsche übertrug und in seine Erzählung aufnahm.
Wie Hlukhovych in Anlehnung an ältere Forschungen ausführt, hatte Rilke eine starke Sympathie für die slawischen Völker. Im Besonderen hält sie dem Dichter zugute, dass er die Ukraine als eigenständige ethnische und territoriale Einheit wahrnahm, während seine Reisegefährtin, die in St. Petersburg geborene Lou Andreas-Salomé, der Sichtweise der Machthaber verhaftet blieb und immer nur von „Kleinrussland“ sprach. Dennoch stellt Hlukhovych fest, dass Rilkes Slawophilie nicht frei von Herablassung gewesen ist. In romantischer Tradition sah er die Tschechen seiner Prager Heimat, aber auch die Russen, und schließlich die Ukrainer als genuin naive Seelen an, die der Ursprünglichkeit und damit dem Göttlichen näher stünden als die verbildeten Westeuropäer. Zu diesem Bild passt natürlich vortrefflich die Geschichte vom Sänger, der mit seinen auswendig vorgetragenen Liedern einen unmittelbaren Zugang zu den einfachen Gemütern seiner Zuhörer findet. Es ist nicht schwer, darin das sentimentale Gegenbild zum modernen Dichter zu erkennen, der vereinzelt vor sich hinarbeitet, seine Bücher zum Druck gibt und sein Publikum nicht eigentlich kennt.
So viel zur „ukrainischen Spur“, die Adrianna Hlukhovych zu Beginn ihres Buchs verfolgt. Im zweiten Teil ihrer Arbeit, die als Dissertation an der Universität München entstand, verlässt die Verfasserin den Sänger Ostap und wendet sich der Tatsache zu, dass sich Rilke auch in anderen Kontexten immer wieder mit dem Phänomen der Blindheit beschäftigt hat. Auf der Basis umfassender Textkenntnis skizziert Hlukhovych also jene Poetik des Blinden, die der Untertitel ihres Buches in Aussicht stellt. Zahlreiche Blinde werden in Rilkes Dichtung beschrieben, und immer werden sie als besondere Menschen vorgestellt: Während sich die Sehenden auf den trügerischen Augenschein verlassen, haben sie das absolute Gespür (oder Gehör) für innere Wahrhaftigkeiten, und während sich die Augenmenschen von der optischen Reizüberflutung irritieren lassen, sind die Augenlosen geduldig aufs Wesentliche ausgerichtet.
Bewegen sich diese Vorstellungen noch weitgehend in einem allgemein geläufigen Blindheits-Diskurs, geht Rilke mit einer anderen Deutung des Phänomens weit über das Übliche hinaus. Das erläutert die Verfasserin am ausführlichsten anhand des Textes „Der Blinde. Paris“, dem das titelgebende Zitat der Studie entnommen ist:
Sieh, er geht und unterbricht die Stadt,
die nicht ist auf seiner dunklen Stelle,
wie ein dunkler Sprung durch eine helle
Tasse geht. Und wie auf einem Blatt
ist auf ihm der Widerschein der Dinge
aufgemalt; er nimmt ihn nicht hinein.
Nur sein Fühlen rührt sich, so als finge
es die Welt in kleinen Wellen ein:
eine Stille, einen Widerstand – ,
und dann scheint er wartend wen zu wählen:
hingegeben hebt er seine Hand,
festlich fast, wie um sich zu vermählen.
Der Unterschied zwischen dem blinden Ostap und diesem namenlosen Großstadtinvaliden springt ins Auge: Während der ukrainische Sänger in seiner ländlichen Umgebung verwurzelt ist, gehört dieser Blinde hier der Stadt Paris nicht an, er „unterbricht“ vielmehr das Kontinuum der optischen Welt. Als „dunkle Stelle“ – oder, wie Hlukhovych sagt, als „blinder Fleck“ – erzeugt er einen „Sprung“, der ihm selbst nicht sichtbar ist, wohl aber dem, der ihn beobachtet (nicht ohne Grund beginnt das Gedicht über einen Blinden mit dem Wort „Sieh“). Rilke untersucht hier, so Hlukhovych, den „Anteil des Blinden an der Sichtbarwerdung“. Dieser Anteil besteht nicht nur in der Konstruktion des besagten „Sprungs“, sondern auch in jenen zarten Gesten, mit denen der Blinde am Ende des Gedichts versucht, zu seiner Umgebung Verbindung aufzunehmen. Sie wären geeignet, einen Umgang unter den Menschen zu begründen, der sich von all den Äußerlichkeiten gelöst hätte, die den Sehenden oft so wichtig sind. Mit ihrer plausiblen Interpretation dieser Verse zeigt die Verfasserin also, dass Rilke Sehen und Nicht-Sehen als komplementäre Wahrnehmungsweisen versteht, und dass er dabei dem Nicht-Sehen im Grunde den Vorzug gibt.
In einem weiteren Schritt ihrer Studie stellt Adrianna Hlukhovych dann Rilkes Versuche vor, mit dichterischen Mitteln dem Sehzwang zu entkommen, also sich gleichsam selbst zur Blindheit zu erziehen. Lyrische Imperative wie „Nun schließe deine Augen. . .“ erfüllen diese Funktion ebenso wie Rilkes ausgeprägtes Faible für Nachtszenen.
Während der Gesichtssinn also eine gewisse Entwertung erfährt, leben die anderen Sinne in Rilkes Dichtung auf. Der Sekundärliteratur ist schon seit längerem geläufig, dass sich im Schaffen des Dichters eine „phonozentrische Wende“ vollzogen hat: Aus Dichtung soll Gesang werden, d.h. die visuellen Eindrücke werden zurückgedrängt zugunsten der akustischen, Musik und Tanz gewinnen an Bedeutung, während Malerei und Bildhauerei, die dem jungen Rilke bedeutsam waren, an Gewicht verlieren. Darüber hinaus zeigt Adrianna Hlukhovych, dass der Dichter auch den Geschmacks- und Tastsinn literarisch erforscht hat, sodass ihre „Poetik des Blinden“ schließlich in einer Poetik der Gleichberechtigung aller Sinne endet.
Diese allseits mobilisierte Sinnlichkeit trägt gewiss zu den poetischen Qualitäten von Rilkes Lyrik bei, behält aber in seinem Schaffen nicht das letzte Wort. Sein Spätwerk zielt aufs Metaphysische, was zur forcierten Unanschaulichkeit jener beiden Werke führt, die ästhetisch anspruchsvollen Lesern mehr zu sagen haben als die schlichten „Geschichten vom lieben Gott.“: die „Duineser Elegien“ und die „Sonette an Orpheus“. Auch das ist Adrianna Hlukhovych nicht verborgen geblieben. Wie viele Rilke-Interpreten weiß auch sie, dass die Sinnlichkeit des Dichters in der Darstellung des Übersinnlichen endete. Dennoch legt sie Wert auf die Feststellung, dass Rilke die Leistung der Sinne zwar transzendieren, nicht aber negieren wollte: „Vor dem Hintergrund des Sinnenentzugs zeichnen sich die Konturen des sinnlich Erfahrbaren umso deutlicher ab.“ Mit diesem dialektischen Fazit endet das ambitionierte Buch, das eine einleuchtende Gesamtdarstellung der Rilkeschen Wahrnehmungsweisen liefert und damit zugleich einen aufschlussreichen Beitrag zur Ästhetik der Moderne.