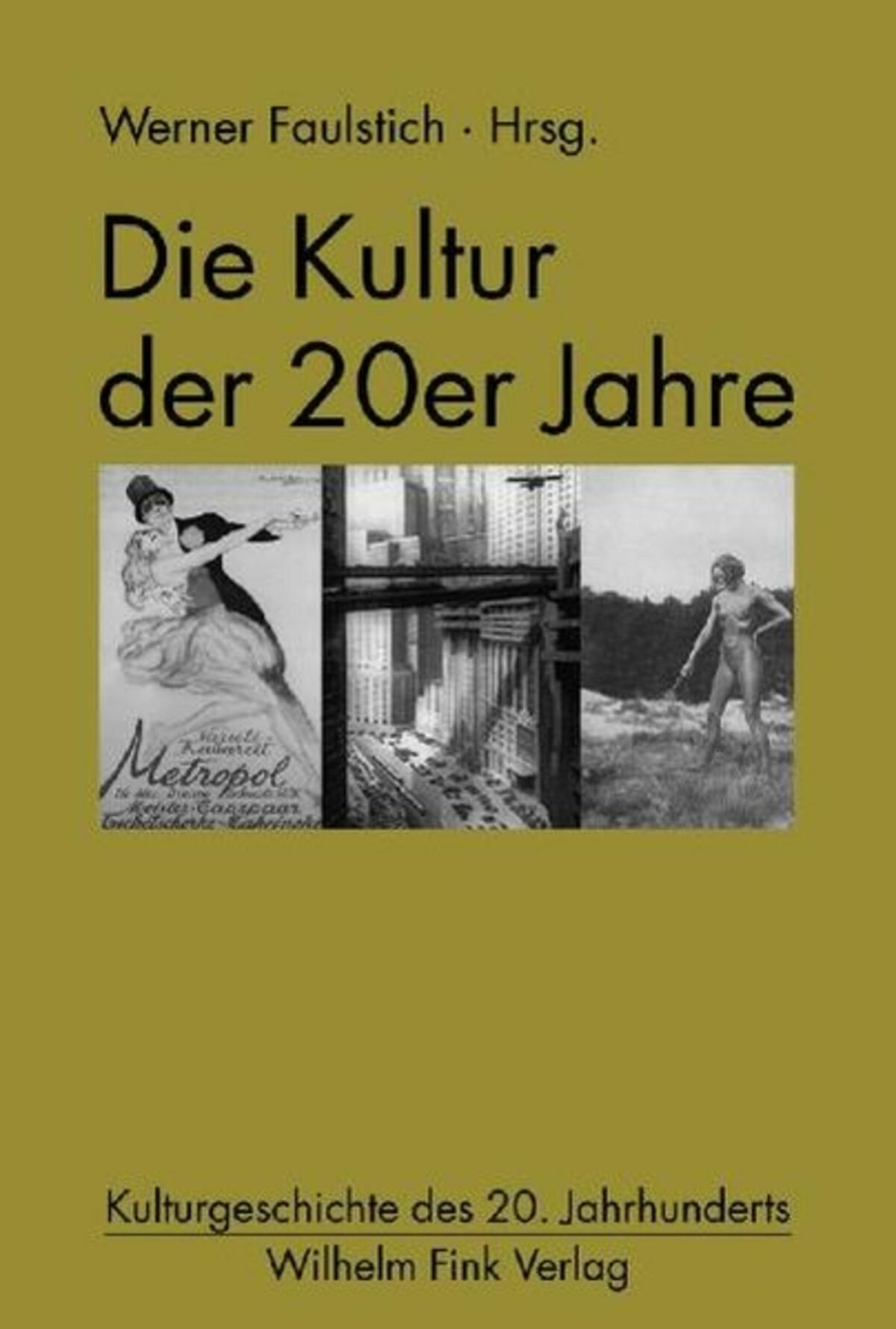Neben fundierten Beiträgen von AutorInnen, die seit vielen Jahren zu „ihrem“ Thema arbeiten – etwa Knut Hickethier über die Entwicklung des Rundfunks oder auch Helmut Korte über die Filmkultur, Melanie Unseld über das Musiktheater oder Rolf Sachsse über Photographie – wird man bei einigen Aufsätzen den Eindruck nicht los, die Autorinnen und Autoren hätten vor der Fülle des mittlerweile in der Sekundärliteratur aufgearbeiteten Materials kapituliert und sich in eine bloße Aufzählung geflüchtet, wo Analyse und Interpretation gefragt gewesen wäre. Vor allem verblüfft zum Teil der völlig fehlende (sozial)historische Bezug.
Die „durchschnittliche wöchentliche Arbeitszeit in Industrie und Handwerk sank von 50,5 Stunden im Jahr 1925 […] auf schließlich nur noch 41,5 Stunden 1932“ (S. 137) ist im Aufsatz über die Geschichte der Werbung zu lesen; ohne den geringsten Verweis auf die Situation der Massenarbeitslosigkeit und Kurzarbeit entsteht hier der Eindruck, es habe sich um eine Phase besonders erfolgreicher Kämpfe der Arbeiterbewegung um Verkürzung der Arbeitszeit gehandelt.
Im Beitrag zum Thema Mode werden die neuen Angestellten als „gut ausgebildete und häufig gut verdienende jüngere Leute“ definiert. Vielleicht ist es eine unlautere Erwartungshaltung, aber man vermisst hier auch hinter der bloßen Aufzählung, wie sich die Mode in diesem Jahrzehnt verändert hat, doch die Frage nach dem warum, vor allem aber nach den sozialhistorischen Folgen und Implikationen dieser Veränderungen. Sätze wie: „Spezielle Freizeitkleidung spielte eine zunehmend wichtige Rolle“ (S. 125), sind in dieser Abstraktheit und ohne Verortung im gesellschaftlichen Spektrum nicht sehr aussagekräftig.
Literaturwissenschaft als Kulturwissenschaft kann nur funktionieren, wenn ein sozialhistorischer Boden eingezogen wird, auf dem sich zusammengetragenes Datenmaterial zu überprüfbaren Befunden und Interpretationen formen kann. Natürlich können bei aufmerksamer Lektüre auch aus bloßen Aufzählungen einige Aussagen herausgefiltert werden – im Kapitel über Mode etwa, wie sehr die radikalen Veränderungen der Frauen- bei gleichzeitig relativer Konstanz der Herrenmode für die Zeitgenossen das „Bild“ der neuen Frau verstärkt haben muss. Aber solchen Fragestellungen nachzugehen wäre doch im Rahmen der hier versammelten Beiträge eine sinnvolle Aufgabenstellung gewesen.
Beinahe schon ein Ärgernis aber ist der Beitrag „Literatur und Literaturbetrieb im dritten Jahrzehnt“. „Die sogenannte Höhenkammliteratur von 1920 bis 1930 stammt von einer stark begrenzten Zahl von Autoren“, heißt es da als Epochenspezifikum. Oder: „Für den ‚Zauberberg‘ als Erziehungsroman ist zentral, dass der Protagonist Hans Castorp Jahre in einem abgeschlossenen Sanatorium mit ‚hermetischem Zauber‘ verbringt […] Die Erziehung misslingt und führt in den Abgrund.“ (161f.)
Oder: „Das Döblin-Beispiel zeigt besonders deutlich zwei charakteristische übergreifende Trends dieses Jahrzehnts auf: einmal von der Lesekultur zur Kultur des Zuschauens (Wengraf 1995, 23) und einer integrierten Medienkultur […], dann von der fiktionalen Ästhetik zum ‚Habitus der Sachlichkeit‘ (Lethen 1995), der sich stärker an der Realität orientierte.“ (S. 165) Außerdem ist zu erfahren: „All diese Autoren bzw. Werke, viele heute im Klassiker-Status, erschienen in Verlagen wie S. Fischer, Insel-Verlag, Verlag Kurt Wolff, Gustav-Kiepenheuer-Verlag, Rowohlt, Die Schmiede, Eugen Diederichs, Albert Langen, Georg Müller u.v.a.“ (S. 163). Und: „Der literarische Rang dieser Literatur erklärt, warum sie heute unser Bild der 20er Jahre weitgehend bestimmt.“ (S. 163)
Hatten Sie nicht zumindest einige Kanonisierungsinstanzen dabei, möchte man mit Brecht fragen, der mit dem epischen Theater übrigens „das Publikum direkt ansprechen“ (S. 166) wollte. Prinzipiell aber vollzog sich beim Theater „ebenfalls die Wendung vom ästhetisch Komplexen zu Zerstreuung und leichter Kost, zum Boulevardtheater (z.B. Hein 1983), bestenfalls nach Art von Ödön von Horváth […] Noch am ehesten wird heute die politische Variante des Theaters in Erinnerung gehalten – ein Medium, das darauf zielte, die Aktualität der Geschichte anschaulich zu machen: ‚Theater als Agitation‘ (Fischer-Lichte 1993, 282ff.).“ (S. 165)
Insgesamt resümiert der Autor: „Der Staat der Weimarer Republik ging mit seinen Autorinnen und Autoren nicht sehr liberal um.“ (S. 168); über die Buchmessen heißt es: „Typisch fungierten sie als Nebenausstellungen allgemeiner Wirtschaftsmessen.“ (S. 169) „Insbesondere die Buchgemeinschaften etablierten sich als ein Instrument, Literatur an verloren gegangene oder auch an ganz neue Lesergruppen zu transportieren,“ (S. 169), „wie überhaupt gelten muss, dass die Branche in den 20er Jahren die professionelle Buchwerbung (‚Buchreklame‘) entdeckt hat: das Buch primär als Ware. […] Klassische Literatur soll nur noch einen Marktanteil von 0,55 % gehabt haben (Raabe 1978, 18)“ (S. 170).
Abgesehen von der Frage nach einem ganz normalen Lektorat, stellt sich hier doch auch die nach den fachlichen Kontrollmechanismen, die beim Zustandekommen dieses Sammelbandes angelegt wurden.