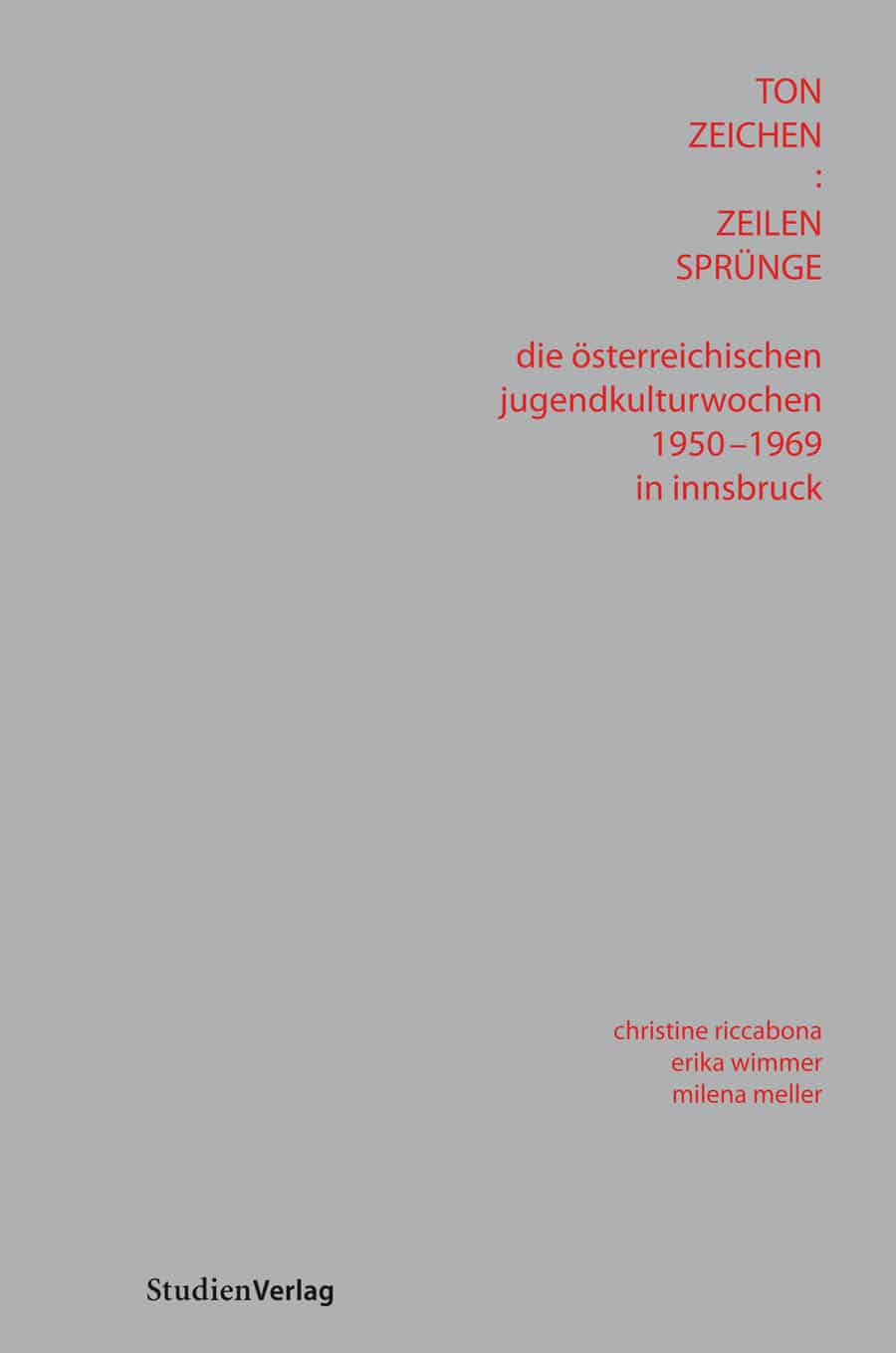Die französische Besatzungsmacht dürfte eine gute Hand bewiesen haben, als sie dem Landesjugendreferenten Arthur Haidl, dem maßgeblichen Gründer der Veranstaltung, die „außerschulische Jugendarbeit“ überantwortete. Dabei war der Rahmen der Veranstaltung durchaus der patriotischen Aufbauzeit, der erwartbaren Brauchtumspflege und „Heimattreue“ geschuldet, es gab (wahrscheinlich weihevolle) Politikerreden zur Eröffnung, Volksmusik zum Thema „Heimat Österreich“ (1950) oder einen „Maitanz“ der Wiltener Stadtmusikkapelle (1951). Konzentriert man sich auf die Literatur, wird aber schnell klar, dass es hier ein lebendiges Nebeneinander von Alt und Neu gab – und im Neuen war man dem Avancierten, das es überall schwer hatte, aufgeschlossen. Das simple (aber bis heute in vielen Institutionen nicht beachtete) Rezept gegen das Aufkommen von Erstarrung war, wie Christine Riccabona in ihrem Beitrag zur Genese der Veranstaltung klar macht, der „ständige Wechsel in der Auswahl der Juroren“. Das Spezifische der Jugendkulturwochen machte zudem der Umstand aus, dass den Einladungen ein Wettbewerb vorausging, für den das Innsbrucker Kulturamt Werbung betrieb, erst später kamen Preise dazu.
Wohl selten wurde eine historische Veranstaltungsreihe so penibel dokumentiert und in ausführlichen Aufsätzen in den Zeitzusammenhang gesetzt wie in dieser Publikation. Würde man das alles in einem Schwung durchlesen (müssen), wäre man von der Fülle an Details wohl bald erschlagen. Aber der Leser wird sich ohnehin das ihn Interessierende herauspicken, was bei der sehr übersichtlichen chronologischen Gestaltung des Buches dankenswerterweise einfach zu bewerkstelligen ist. Dieser Umstand macht das Buch gemeinsam mit dem Personenregister zu einem benützerfreundlichen Grundlagen- und Nachschlagewerk. Pickt man sich die Literatur als Lektürefokus heraus, zeigt sich das Besondere der Österreichischen Jugendkulturwochen nicht zuletzt in der Mischung der Teilnehmer. Arrivierte und durchaus konservative Autorinnen wie Christine Busta oder Gertrud Fussenegger agierten als Mentorinnen der Jungen, und die in Innsbruck lebende Ingeborg Teuffenbach wurde gar von einer ehemaligen NS-Autorin zu einer Verfechterin avancierter Richtungen, ab den sechziger Jahren nahm sie schließlich die Rolle der „Gastgeberin“ ein und wurde von den jungen Teilnehmern durchaus geschätzt. In den fünfziger Jahren, als das Kulturklima alles andere denn aufgeschlossen war, scheint man, wie Riccabona schreibt, in Innsbruck „weniger rigid“ gewesen zu sein. „Zwar war auch hier Skepsis und Unverständnis zu finden. […] Wichtiger schien aber, dass die ‚jungen Schaffenden‘, wie sie im Jargon der Zeit genannt wurden, überhaupt zum Zug kamen.“
Andreas Okopenko, Gerald Bisinger oder Hanns Weissenborn etwa lasen, Friederike Mayröcker und Ernst Jandl lernten sich hier 1954 kennen. Und auch einige von jenen, die man bald zu den Bekanntesten der österreichischen Literatur zählte, waren am Fuße der Nordkette zu Gast, so Ilse Aichinger und Thomas Bernhard (1956). Ingeborg Bachmann kam 1957, das schönste Faksimilie des Buches ist ihr Zusage-Brief an die Organisatorin Lilly von Sauter. Wie Erika Wimmer schreibt, machte man bei den Jugendkulturwochen keine „Entdeckungen“, aber es war „ein Verdienst der Veranstaltung, dass junge Autoren, welche gerade von sich reden machten, auch gleich in Innsbruck auftreten konnten.“
Zum speziellen Innsbrucker Klima, dem auch die Entfernung zur „Kulturzentrale“ Wien sicher nicht geschadet hat, gehörten die Offenheit und das „dialogische Prinzip“ (Riccabona), traditionelle Erzählformen und neue, sprachkritische poetische Verfahren traten hier in den Sechzigern tatsächlich in einen Dialog, zentrale Elemente der Veranstaltung waren Arbeitskreise und „Werkstattgespräche“. Daraus ergaben sich für alle Beteiligten wichtige Vernetzungen, Freund- und Liebschaften, hinzu kommt, dass Rundfunksendungen die Veranstaltung begleiteten und sich aus der Anwesenheit von Verlagslektoren wichtige Kontakte ergaben.
Die avantgardistische Schlagseite, die das Festival seit Beginn der 1960er Jahre aufwies, wurde schließlich mit zu einem ihrer Verhängnisse. Die Geschichte vom Ende der Österreichischen Jugendkulturwochen ist der unterhaltsamste Teil der Abhandlung. Die 20. Auflage der Veranstaltung 1969 wurde zu einem Erfolg, Elfriede Jelinek, die 1967 erstmals mit einer Sammlung Salzburg, Wien: Residenz, 1993/1997. 224 S., brosch.; öS 495.-. ISBN 3-7017-1096-1.erotischer Gedichte nach Innsbruck kam, wurde zur Doppelsiegerin, sie gewann überraschend in den Sparten Prosa und Lyrik (die beiden unabhängigen Jurys kannten die Namen der Einsender nicht). Aber nicht alle waren von der Preiswürdigkeit ihrer Arbeiten überzeugt, der oberösterreichische Landesjugendreferent sprach davon, dass Jelineks Siegertexte „unter der Einwirkung von Drogen“ entstanden sein müssen. Diese Beurteilung entstand jedoch unter dem Eindruck von Berichten über Tumulte, so war der Eröffnungsredner von drei jungen Künstlern unterbrochen worden, die ein Manifest verlasen. Die zeitgenössische Protest- und Jugendkultur war bei den Jugendkulturwochen angekommen. Unterhaltsam ist der im Faksimile abgedruckte Brief des Managers der Kulturwoche, Gerhart Engelbrecht, der sich veranlasst sah, sich in einem Brief an die aufgebrachten Landtagsabgeordneten und Innsbrucker Gemeinderäte von den Künstlern zu distanzieren, er schrieb von „krankhaftem Geltungsbedürfnis“, von jungen Leuten mit „langen Haaren“ und Leuten, „die nicht sehr sauber gewaschen sind“. Die Veranstalter wollten und konnten der Avantgarde nicht mehr bedingungslos folgen, Sponsoren und der ORF zogen sich wegen der „Tumulte“ zurück, es war offensichtlich nicht möglich, die Veranstaltung zu erneuern.
Nach der Lektüre drängt sich die spannende Frage auf, wie heute, knapp 30 Jahre später, eine dialogische Veranstaltung für „junge Schaffende“ in den Sparten Literatur, Musik und bildende Kunst aussehen könnte.