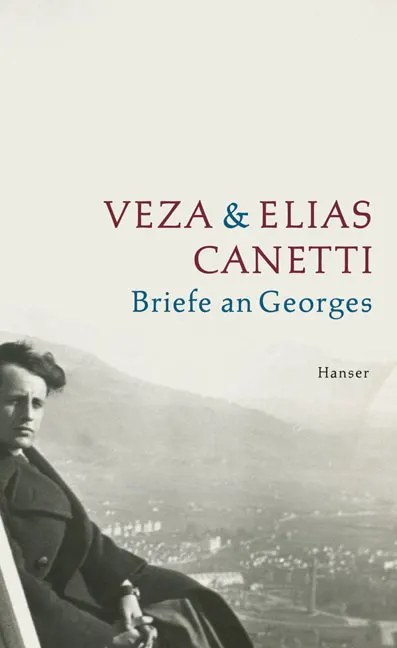Elias Canettis Kontrollbemühungen gingen aber noch weiter: So hat er den Briefwechsel mit seiner ersten Frau Veza und offensichtlich auch den mit Georges, dem jüngeren seiner in Paris lebenden Brüder, vernichtet, wohl um Korrekturen des Bildes zu verhindern, das er – rezeptionssteuernd – in seinen autobiographischen Schriften von sich, aber auch von Veza, gezeichnet hat. Ganz ist ihm dies allerdings nicht gelungen, fanden sich doch 2003 in einem Pariser Keller aus dem Nachlass von Georges Briefe von Veza (knapp 120) und Elias (rund 40) an den Schwager beziehungsweise Bruder sowie ein Brief von Georges an Veza, den dieses ihm zwecks Verwahrung zurücksandte, und einige Entwürfe von Briefen von ihm an Veza und Elias, schließlich eine Handvoll Belege aus dem Briefwechsel des Ehepaars, die Veza ebenfalls dem Schwager übermittelte. Diese Zeugnisse – in der vorliegenden Ausgabe sorgfältig ediert, illustriert mit 15 Photos und 4 Brief-Faksimiles, vor allem aber auch klug und informativ kommentiert – stammen aus dem Zeitraum von Juni 1933 bis Mai 1939, dann wieder von Oktober 1944 bis August 1948. Ein Brief von Veza an Georges vom Mai 1940 sowie je ein Brief von ihr und Elias an den Schwager/Bruder vom Sommer 1959 fallen zeitlich aus dem Rahmen. Ob es keine weiteren Briefe gab oder ob welche vernichtet wurden, darüber ließen sich nur Spekulationen anstellen.
Nach der Lektüre dieses „Briefroman[s] einer unauflösbaren Dreiecksgeschichte“ (so der Klappentext) verwundert es nicht, dass Elias am Erhalt der Dokumente kaum gelegen war, zeichnen sie doch ein wenig schmeichelhaftes Bild von ihm. Das ist jedoch nicht so sehr überraschend, denn die (allerdings vom Autor nicht selbst redigierten), zum Teil an Bösartigkeit in Porträts (etwa von Iris Murdoch oder T.S. Eliot) kaum zu überbietenden Erinnerungen an die englische Zeit in Party im Blitz (2003) lassen Elias Canetti nicht gerade vornehm erscheinen und bestätigen seine gesprächsweise gegenüber Mechthild Curtius getroffene Feststellung, er „schreibe aus Hass“. Und Sven Hanuschek hat mit seiner großen Canetti-Biographie bereits 2005 ein sehr differenziertes Porträt des Literaturnobelpreisträgers gezeichnet, vor allem aufgrund des „Zentralmassivs“ von Canettis Schaffen (so Hanuschek), das heißt aufgrund der im Nachlass gefundenen, erst zu etwas mehr als zehn Prozent veröffentlichten Aufzeichnungen, nicht zuletzt aber auch dank dem für den Biographen gerade noch rechtzeitigen Fund der nun publizierten Briefe. Eigenschaften wie Elias Canettis tyrannisches Verhalten gegenüber Veza oder seine (aufgrund der ökonomischen Verhältnisse) zwar verständlich problematische, allerdings auch verlogene Beziehung zu Geld lassen ihn einerseits wenig sympathisch erscheinen, andererseits besticht er jedoch durch Einsicht und Selbsterkenntnis, akzeptiert etwa widerspruchslos Georges‘ Vorwurf des Hangs zur „Prahlerei“, spricht offen von seiner „unendlichen Ruhmsucht“ und seinem „natürlichen Grössenwahn“, der im übrigen – wie Veza dem Schwager mehrfach verzweifelt meldet – mit tiefer Depression wechselt, oder charakterisiert schonungslos und treffend sein Verhältnis zur Mutter als das einer „ganz tiefen und geradezu gefährlichen Liebe“, „einer paranoischen Beziehung“: „aber als solche ist sie so intensiv wie keine andre in meinem Leben; konkreter ausgedrückt: wie die Mama über mich denkt, was sie von mir denkt, was sie von mir erwartet, ob sie stolz auf mich ist oder mich verachtet – das ist mir vielleicht, wenn auch im einzelnen selten bewusst, doch wichtiger als alles andre. Aber ihre Gegenwart ist mein Tod; in einem Zimmer mit ihr müsste ich ersticken oder mich erhängen, das ist keine Phrase.“ Das Leiden unter ihrem Zweifel an seiner dichterischen Sendung (bis zum verspäteten Erscheinen der „Blendung“) könnte kaum drastischer formuliert werden und lässt Canettis Überempfindlichkeit im Hinblick auf Bewertungen seines schriftstellerischen Schaffens und auf sein – um es etwas altmodisch, gleichwohl für ihn zutreffend auszudrücken – Sendungsbewusstsein als Dichter verständlich werden. Nicht weniger scharfsinnig als sein Verhältnis zur Mutter analysiert er seine psychische Gefährdung, von ihm zutreffend als Paranoia gedeutete Wahnsinnsanfälle, die ihn ein „Hölderlin-Schicksal“ befürchten lassen und unter denen Veza nach Ausweis ihrer Briefe an Georges bis zur totalen eigenen psychischen und physischen Erschöpfung leidet, die er aber mit der Zeit in Selbsttherapie in den Griff bekommt.
Veza und Georges gehörten zweifellos zu den Menschen, die Elias „am meisten liebe“, sein Verhalten schwankt dennoch zwischen dem Singen von Hoheliedern auf die beiden und der Erniedrigung von Veza, vor allem durch seine exzessiven Frauenbeziehungen, sein (abgesehen von anderen Liaisonen) geradezu wahnhaftes Verfallensein an Anna Mahler und Friedl Benedikt, sowie größeren und kleineren Streitigkeiten mit Georges. Elias Canetti neigt zu Extremen, zum abrupten Wechsel von überschwänglichen Bekundungen der Zuneigung zu Hasstiraden. Aber auch das ist nicht neu – man denke an sein im autobiographischen Augenspiel geschildertes Verhalten gegenüber dem Freund Fritz Wotruba -, manifestiert sich aber in seinen Briefen erneut.
Interessanter als die Briefe von Elias sind die Vezas an Georges. Wohl ist bekannt, dass sie – vermutlich nach zwei Abtreibungen – vom Fach der Geliebten explizit in das der „Mutter“ gewechselt hat, dass sie unter dem „egoistischen Quälgeist“ Elias, seinen Eskapaden, seinen Zusammenbrüchen, unter seinen „Kurtisanen“, speziell unter Friedl Benedikt, die seine Arbeit blockiert, ihm Geld aus der Tasche zieht und ihn mit Männergeschichten verrückt macht, bis zur Verbitterung gelitten, gleichwohl ihm zuliebe gerade auch die letztgenannte bis zur Selbstverleugnung hofiert hat. Zur „Vernunft“ bringt sie ihn mit Suicid- und Scheidungsdrohungen, die wiederum ihn in Panik versetzen, nicht zuletzt, weil er dann seinen Schutzschild gegen die befürchteten Ansprüche seiner „Kurtisanen“ verlöre. Vezas Selbstlosigkeit verdankt sich eben ihrer mütterlichen Einstellung gegenüber Elias, ihrem „genialen Kind“, das sie zärtlich „Murkl“ oder „Bauscherl“ nennt, sowie ihrem unbedingten Glauben an seine schöpferischen Fähigkeiten und – schon sehr früh – an ein Nobelpreis würdiges Werk aus seiner Feder. Elias, obwohl häufig gekränkt wegen Erfolglosigkeit und fehlender Anerkennung, kümmere sich, so eine Hauptklage Veza gegenüber Georges, zu wenig um die Beförderung seines Werks, vernachlässige seine Geschäftskorrespondenz (was Veza auszugleichen versucht, zum Teil mit gefälschter Unterschrift), versäume wichtige Reisen (zum Beispiel in die Schweiz, um die Kontrolle über Friedl Benedikt nicht zu verlieren). Und so ringt Veza um das Werk ihres Mannes, kämpft gegen seine Arbeitsprobleme, Zauderhaftigkeit und auch „Faulheit“, wiederum unter Einsatz der genannten Druckmittel.
Georges spielt für Veza in ihrer Verzweiflung eine wichtige Rolle. Mit ihm kann sie sich in ihren Briefen über ihre Probleme mit Elias aussprechen. Sie, die in der Ehe Liebe vermisst, betet den 13 Jahre jüngeren Schwager geradezu an („Süsser Georg“, „Liebster“, „Darling“), sieht in ihm zeitweise ihre einzige Stütze, in seinen Briefen gar die „Essenz“ ihres Lebens. Im März 1946 verliert der schon in jungen Jahren, als 22-Jähriger, sowohl durch seine analytischen Fähigkeiten als auch seine stilistische Reife als Briefschreiber überzeugende, sonst sehr sensible, eher ruhige, gelassene Georges (im einzigen in der endgültigen Fassung erhaltenen Brief) die Contenance und ergreift uneingeschränkt die Partei der Schwägerin: „Meine Liebste, ich bin außer mir nach dem, was Du schreibst; Deine Größe und Deine Güte, werden ihn nicht retten, er ist schrecklich […] das soll mein Bruder sein! Das ist kein Mann, das ist ein Lumpen […] Und das nach diesen Jahren des Schreckens [des NS-Terrors], in denen auch der letzte Trottel begriffen hat, was wirklich wichtig ist […] Gewiß, ich liebe ihn; aber diese Liebe ist so unablässig durchkreuzt worden von Enttäuschungen – darüber, wie er mit seiner Mutter umgegangen ist, über seine Faulheit, über eine Schwäche in bezug auf Geld, über seine [schöpferische] Unfruchtbarkeit (am schlimmsten!), über seine albernen Abenteuer, über seine Überheblichkeit etc. -, dass sie blaß, leblos und kraftlos geworden ist“.
Die wenigen Zeugnisse von Georges lassen bedauern, dass nicht mehr von ihm an Korrespondenz erhalten ist. Sie wecken die Neugier. Herausragend in der vorliegenden Edition sind zweifellos die Briefe Vezas, die speziell die von Elias an stilistischer Brillanz bei weitem übertreffen. Sie sprühen von Witz, Ironie, auch Selbstironie (etwa im Umgang mit ihrer äußeren Erscheinung), sprachspielerischer Leichtigkeit, gleiten trotz ihrer gelegentlichen Verzweiflung und Verbitterung wegen des Leidens an ihrem Mann nie in Larmoyanz ab. Und trotz ihrer Sorgen verliert sie die Probleme des Briefpartners nicht aus den Augen. Besonders bemerkenswert, wie sie durch Überspielen ihre anfängliche Befangenheit wegen der Homosexualität des Schwagers überwindet und sich positiv darauf einstellt. Vor allem aber sorgt sie sich – diese Angst teilt sie mit Elias – um die Gesundheit des schon in jungen Jahren an Lungentuberkulose erkrankten Georges, dessen Bazillen sie „wegküssen“ möchte.
Nur selten sprechen Veza und Elias die politischen Ereignisse und Verhältnisse direkt an. Wenn sie es tun, lässt sich ihre Scharfsichtigkeit erkennen. So in Elias‘ Durchschauen der „anheimelnden Wiener Form“ von „Bestialität“ im März 1934 oder in seiner Ahnung des „kommenden Krieg[s] in Europa“ im August desselben Jahres, oder in Vezas an Prägnanz kaum übertreffbarer Charakterisierung ihrer Lage im März 1938. Schon zu Beginn dieses Monats ist ihr bewusst, dass sie nur einen „Aufschub“ erhalten hätten, bevor „Hitler ’seine schwere hand auf Österreich legen‘ [werde,] wie es in den Zeitungen steht“. Am Ende desselben Monats konstatiert sie: „hier werden die Menschen eingeteilt in Arier, Halbarier, ? Arier, ? Arier, Hunde und Juden. Um die Hunde kümmert sich der Tierschutzverein.“
Nach 1945 versetzten die Atombombenabwürfe die beiden in Schrecken. Aber da findet Veza wieder den ironischen Ton, wenn sie dem Schwager mitteilt, Elias fürchte wegen der neuen totalen Vernichtungsmöglichkeit um seine Unsterblichkeit, und immerhin mit einer gewissen Genugtuung feststellt, dass diese Furcht seinen Arbeitseifer befeuere. Wie man weiß, à la longue mit Erfolg.