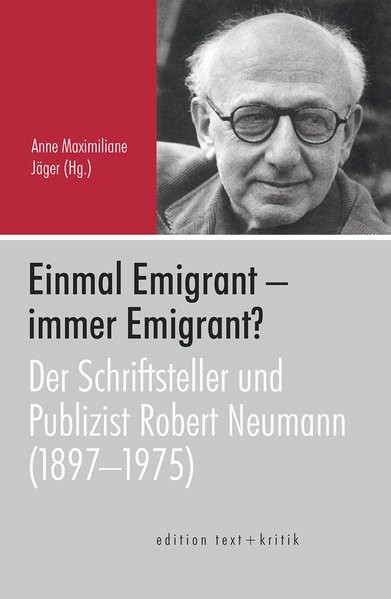Zwar hat sich der Piper Verlag noch in den 90er Jahren im Zuge einer Neuauflage des (außer in Österreich) einst recht erfolgreichen, in mehrere Sprachen übersetzten Romans Die Kinder von Wien (1974, ursprüngl. The Children of Vienna, 1946) für eine Wiederentdeckung stark gemacht, doch auch dieser Versuch stieß, wie bereits vorangegangene, auf bescheidene Resonanz. Richtig nachvollziehbar ist diese Rezeptionslage eigentlich nicht, zumal Neumann aufgrund einzelner Texte bzw. Neuauflagen, z.B. des 1931 erstveröffentlichten Romans Karriere, sowie über kulturpolitische Initiativen im PEN (Durchsetzung der Wahl von Heinrich Böll 1971) sowie im Minenfeld des deutsch-deutschen Verhältnisses (siehe dazu den als „Erinnerungen“ an R. N. deklarierten Eröffnungstext von Friedrich-Martin Balzer) bis in die frühen 70er Jahre im Feuilleton recht gut vertreten war und dabei auch manche publizitätsträchtige Provokation nicht scheute. Doch das Exil sollte sich als fortwährendes herausstellen, ein Schicksal, das zu einem Teil auf die tendenziell exilfeindliche Einstellung der Gruppe 47, gegen die Neumann prononciert und polemisch Stellung bezog, sowie auf namhafte Kreise in der Germanistik und der Literaturkritik zurückgeführt werden kann, welche mit einem von Brüchen keineswegs freien, unangepassten Werk und mit der mitunter eigenwilligen Haltung des Autors wenig zu tun haben wollte.
Dieser Ausgrenzung, zumindest von den Folgen her gesehen, will der vorliegende Sammelband, Ergebnis einer Tagung an der Universität Siegen (2006), entgegen steuern. Er besteht aus zehn Beiträgen, ergänzt durch einen Umfrageabdruck aus dem Jahr 1928 sowie eine nützliche Zeittafel.
Beginnend bei den publizistisch-literarischen Anfängen um 1926/27 in deutschen Zeitungen sowie – über Vermittlung von Ernst Lissauer – im Engelhorn-Verlag, welche von Nikolaus Gatter rekonstruiert werden, bis hin zu den zunehmend autobiographischen Büchern der 60er Jahre bemühen sich die BeiträgerInnen, exemplarisch sowohl die Breite des Werkes, dessen formale und ästhetische Vielschichtigkeit, als auch lebensgeschichtlich zentrale Erfahrungen, allen voran jene des Exils und des temporären, erstaunlich gut geglückten Sprachwechsels ins Englische in den Blick zu nehmen. Durchwegs genau recherchiert und zudem (auch dank eines parallel laufenden FWF-Projektes) neues Material präsentierend gelingen dabei mehr als nur kaleidoskopische Schlaglichter auf den Autor und sein Werk. Besonders verdienstvoll ist Alfred J. Nolls Hinweis auf die beiden „desillusionierenden Zeitromane“ Sintflut (1929) und Die Macht (1932), die Neumann ästhetisch wie politisch auf der Höhe der Zeit zeigen, als messerscharfen Analytiker und Visionär, der über ein prall-deftiges wie menschlich zwiespältiges und damit wiederum zeitgemäßes Figurenarsenal die von Innen aufbrechenden, zentrifugalen sozialen Verhältnisse und Interessenslagen zugespitzt zwar, aber im Rückblick frappierend realitätsnahe und auch heute noch lesenswert zum Thema gemacht hat.
Im Mittelpunkt des Bandes stehen jedoch – die Frage im Buchtitel einkreisend – Aspekte des Exilschaffens bzw. Herausforderungen und Nachwirkungen des Exils. Richard Dove, anerkannter Exil- und Neumann-Experte, stellt die Jahre 1939 bis 1945, in denen der Autor den Sprachwechsel riskierte, unter das Motto „Ein schweres Leben“ (in Abwandlung des Titels der Autobiographie) und meint damit vor allem den psychologischen Druck, dem die ExilantInnen auch in Großbritannien ausgesetzt waren, so z.B. im Zuge der Internierungserfahrung von 1940. Dieser Druck habe auch bei Neumann trotz beachtlicher Resonanz auf und den – freilich noch auf Deutsch abgefassten, aber zuerst auf Englisch veröffentlichten – Roman An den Wassern von Babylon (1939) sowie auf The Inquest (1942) eine Art „dual personality“ zur Folge gehabt. Andererseits erlaubte ihm diese Dualität bzw. dieses Aufspaltungsgefühl, sowohl in der englischen Kultur und Kulturpolitik Fuß zu fassen, etwa bei der BBC, die immerhin im März 1943 eine eigene Österreich-Programmschiene einrichtete, als auch im „Free Austrian Movement“ und im Internationalen wie im Österreichischen Exil-PEN wichtige Vermittlerrollen einzunehmen.
Ein weiteres wichtiges und bislang kaum bearbeitetes Feld wird von Christian Cargnelli rekonstruiert: die Filmarbeit Neumanns, meist entstanden in Kooperation mit deutschen Exilanten aus der Film- und Theaterbranche wie Elisabeth Bergner, Fritz Kortner, Alexander Korda, Berthold Viertel, Lothar Mendes u.a., Filme, die geprägt waren von antifaschistischer Bewusstseinsarbeit und produktiver Ausschöpfung der Möglichkeiten des Mediums ohne dabei zu übersehen, auch Teil einer in England wesentlich von ExilantInnen mitgeprägten Unterhaltungsindustrie zu sein. Wie couragiert und experimentell Neumann diese Arbeit anging, zeigt das Script zum Propaganda-Kurzfilm These are the men (1943). Ausgehend vom NS Propagandafilm Triumph des Willens (L. Riefenstahl), den Neumann als Materialfundus verwendet, werden darin die plakativen Vorgaben des Ministry of Information über teils satirische Verfremdung, teils schockierend-didaktische Dokumentation (authentisches Bildmaterial von Kriegsverbrechen) und zudem mit dem von Thomas Dylan poetisierten Text kongenial mit politischen wie künstlerischen Messages überblendet, um sich würdig in eine Reihe prominenter Exil-Kurzfilme (z.B. von A. Koestler) zu stellen.
Das Themenfeld Exil dominiert auch Texte der späten 40er Jahre, wozu Franz Stadler werkgeschichtliche Anmerkungen zum Roman Children of Vienna (1946) auf der Basis seines Nachlassprojektes anbietet, während Jörg Thunecke das Beispiel des komplexen, aber nahezu unbekannten Romans Blind Man’s Buff (1949; dt. Blinde Kuh, dzt. noch unveröffentlicht) herausgreift und vor dem Hintergrund englischer Studien über Self-Deception auf Formen der Selbst-Täuschung und daraus resultierender Strategien der Verdrängung zur Diskussion stellt. Ein Identitätstausch nach einem Mord an einem jüdischen Geschäftsmann, Erpressungen, Arisierungsverfahren und kaum verdeckte erotomane Rivalitäten um die Ersatzvaterrolle zweier Männer um ein Mädchen im Umfeld des Anschlusses von 1938 eröffnen ein skurriles Szenario, das alsbald zu fatalen Konsequenzen führt, zu einer fast unglaubhaften Trübung des Blicks, die in Haft- und Lagererfahrungen mündet, ja selbst in freiwillige Deportation 1943 nach Treblinka, Mauthausen bzw. Ebensee. Dort büßt Marx – so der Name des Protagonisten – nach medizinischen Experimenten einen Teil seiner Sehkraft ein, was zur Folge hat, dass er auch nach 1945 in diesem surrealen Zirkel aus (Selbst)Täuschungen verharrt und ihm zunehmend die Fähigkeit abhanden kommt, der Realität buchstäblich ins Auge zu schauen. Es scheint, als habe Neumann in diesem Roman Verfahren der Verfremdung, Irritation und Provokation (wie sie später bei Drach oder Hilsenrath üblich werden) experimentell skizziert und damit früh einen ungewöhnlichen (wie übersehenen) Text zur Lagerwahrnehmung und zur Shoah vorgelegt. Jedenfalls haben Zeitgenossen und Exilgefährten wie Elisabeth Freundlich – „ein völlig neuer Ton“ bzw. „eine gespensterhafte Clownerie ohnegleichen“ oder Lion Feuchtwanger dem Roman ein besonderes Potential – „wie eine wilde Ballade“ – zugesprochen.
Den autobiographischen Büchern (Mein altes Haus in Kent, 1957; Ein leichtes Leben, 1963) sowie dem Typoskript-Journal über seinen 1944 früh verstorbenen Sohn Henry/Heini sind die Beiträge von Hans Wagener und der Herausgeberin A. M. Jäger gewidmet. Während Wagener seinen Akzent auf den Vergleich der beiden publizierten Bücher legt und dies vor dem Hintergrund klassischer Forschungspositionen (von Lejeune bis G. De Bruyn) tut, um signifikante Techniken zu markieren (exzessives Selbstzitat, intertextuelle Referenzen, Aussparung von traumatischen Erfahrungen und Überhöhung von z.T. banalen Anekdoten), welche klar erkennbar eine Tendenz zur Fiktionalisierung sowie zum kalkulierten Unterhaltungseffekt sichtbar machen, konzentriert sich Jäger auf die ihrer Ansicht nach modernen Strukturelemente der späteren Autobiographie wie z.B. die „Ablösung der Chronologie durch die Konstruktion“, die Brechung des erinnernden Berichts in mehrere Zeitebenen und den damit verbundenen Montage-Charakter.
Mit dem skandalumwitterten Roman Olympia (1961), angekündigt als eine „Art Gegenstück zum Felix Krull […], Ergänzung und lächelnde Fortsetzung“, gegen den die Mann-Erben und der Fischer-Verlag vor Gericht zogen, um sich nach üblem Schlagabtausch und bloß wenigen, abzuändernden Zeilen doch zu vergleichen, setzt sich Holger Pils auseinander. Dass hier die Ingredienzien kalkulierte Verlagsspekulation und gesuchte Provokation auf der einen, verdeckte Eitelkeit und priesterliche Arroganz auf der anderen Seite zu einem Lehrstück zusammenfanden, dämmerte zwar schon einigen Zeitgenossen, tritt aber erst jetzt so richtig in den Blick. Die strukturellen Aspekte dieses stark aus Texten der 30er Jahre collagierten, von Neumann vielleicht doch überschätzten Romans, der mit dem Krull-Szenario eigentlich nur die hintergründige Parodie auf das eigene Künstlertum und das Schreiben insgesamt teilt, gingen dabei völlig unter und damit auch die angeblich mitbeabsichtigte „Huldigung“ auf Thomas Mann und dessen Exilverdienste.
Ob sich die Hoffnung der Herausgeberin auf eine intensivere Rezeption des Neumannschen Werkes erfüllen und der Band entsprechende Neuauflagen nach sich ziehen wird, bleibt abzuwarten; für die (Exil)Forschung ist der prominent platzierte Band zweifellos als wichtiger Grundstein anzusehen, der nicht ungenützt bleiben sollte. Denn ihr wie gerade den LeserInnen wäre die Lektüre von einigen Texten doch zu gönnen, von frühen Erzählungen, dem prallen Roman Die Macht und den sprachlich wie von der Komposition her eigenwilligen großen Exil-Romanen im besonderen.