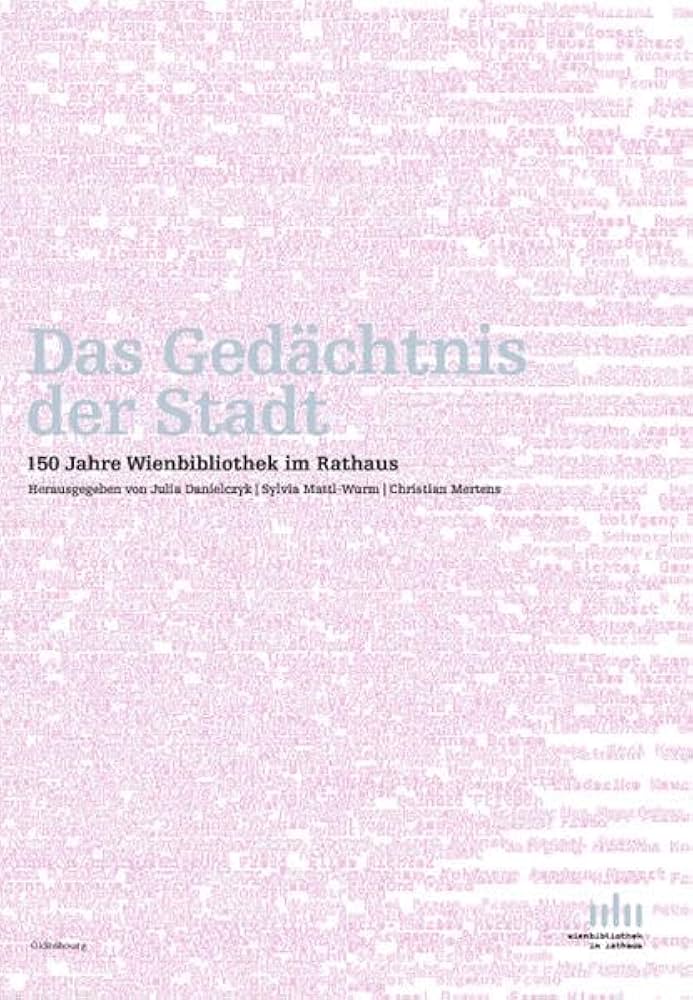Nicht nur einen neuen Namen gab sich die Bibliothek, unter dem Titel Das Gedächtnis der Stadt schenkte sie sich und der interessierten Leserschaft einen exemplarischen Jubelband: fundiert, Abbildungen in bester Qualität, grafisch und typografisch anregend und elegant, dabei nicht protzig – nimmt man dieses Buch als Parameter für die zukünftige Entwicklung der Institution, die, so war zum Jubiläum in Schlagzeilen zu lesen, ihr „Schattendasein beenden“ wolle, so kann man diesbezüglich nur voller Zuversicht sein.
Vielleicht spiegelt sich in der typografischen Verschmelzung von „Wienbibliothek“ der historisch wahre Kern der Verknüpfung von Stadt/Magistrat und Bücherspeicher: Wie wir aus Verena Pawlowskys Beitrag zu den ersten fünfzig Jahren der Institution erfahren, war die Stadtbibliothek zu Beginn (als Ein-Mann-Betrieb) ein „rein internes Hilfsamt der Stadtverwaltung“ – und noch heute fungiert die Bibliothek als eine Magistratsabteilung (MA9). Das sagt allerdings wenig über die Wirkung in der und auf die Stadt aus, den Autorinnen und Autoren der 14 Beiträge ist es besonders um die jeweilige Situiertheit der Bibliothek im Zeitgeschehen zu tun. Pawlowsky etwa verweist auf die Kanonbildung durch die Bibliothekare und Archivare zur Zeit der Stadterweiterung ab 1880, als hier entschieden wurde, welche Namen neue und eingemeindete Straßen oder welche Personen ein Ehrengrab bekommen sollten, auch ein beträchtlicher Teil der „Stadtbeschriftung“ – Texte auf Denkmälern und Gedenktafeln“ – wurde hier verfasst.
Das Schicksal der Bibliothek in Kriegszeiten ist natürlich von besonderem Interesse, gilt doch die Frage genau zu klären, inwieweit eine solche „objektive“ Stätte der Sammlung ideologisch instrumentalisiert wurde. Verena Pawlowsky durchleuchtet die dunklen Jahre des Ersten, der Mitherausgeber Christian Mertens jene des Zweiten Weltkriegs. Man scheut also nicht vor Vergangenheitsbewältigung zurück, Pawlowsky erwähnt allerdings eine „Kriegssammlung“ sowie ein „Kriegsstammbuch“ aus der Zeit zwischen 1914 und 1918 – darüber hätte man gerne mehr gelesen. Sollte sich diese Lücke aufgrund mangelnder Erforschung aufgetan haben, steht zu hoffen, dass diese bibliothekarische Indienststellung bald genauer erforscht und dargelegt wird.
Den drei HerausgeberInnen war es ein Anliegen, nicht nur die vergangenen 150 Jahre Revue passieren lassen, sie wollten offensichtlich möglichst verschiedene Bereiche abdecken und so jedem Leser nach seiner Façon etwas bieten: Andreas Brunner etwa führt durch die Erotika der Sammlung Batsy; Gerhard Renner, stellvertretender Leiter der Institution, führt vor, dass selbst eine trockene Materie wie Katalogisieren ein spannendes Forschungsfeld sein kann, er beschreibt den Schicksal des Katalogs im Austrofaschismus und „Dritten Reich“, als Verbotsvermerke in verschiedenen Ausführungen Konjunktur hatten; Norbert Linke berichtet von seinen Forschungen zur bürgerlichen Tanzmusik und Operette; und schließlich war es eine schöne Idee, Leser und Forscher mit ihren persönliche Eindrücken von Recherchen in der Bibliothek zu Wort kommen zu lassen. Die Schriftstellerin Claudia Erdheim etwa singt ein Loblied auf ein äußerst wichtiges Detail jeder Bibliothek – die Bestuhlung: „Auch die besten Sesseln von allen Bibliotheken, die ich kenne, hat die Wienbibliothek. Groß, weich, verstellbar. Einfach super.“
Auf den Sitzen, zu seiner Zeit allerdings sicher noch karger und härter, hat sich auch der englische Philologe Edward Timms wohlgefühlt, als er sie im Rahmen von Recherchen für sein Karl-Kraus-Buch drückte. Ihm wurde der Aufenthalt im Lesesaal seit Beginn der sechziger Jahre immer wieder zum „Abenteuer“, gab es hier – in Timms Fall im Karl-Kraus-Archiv – doch stets neue Entdeckungen zu machen. So fand der heute 70-jährige, nach wie vor in der Kraus-Forschung umtriebige Timms in der Handschriftensammlung Briefe Kraus‘ an einen befreundeten Offizier, die ihm als Belege dienen, die Auffassung, Karl Kraus habe sich sofort nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs in einen Antimilitaristen gewandelt, zu widerlegen. An solchen Mosaik- und Puzzlesteinchen, an dieser „beschrifteten Luft“, wie Friederike Mayröcker in dem Text „Archiv“, welcher der ihren Vorlass aufbewahrenden Institution gewidmet ist, schreibt, erfreuen sich die Forscher – und in diesem Fall die Leser. Hoffentlich muss man auf weitere Eigenberichte aus den Magazintiefen und Forschungshöhen der Wienbibliothek nicht bis zum nächsten Jubiläum warten.