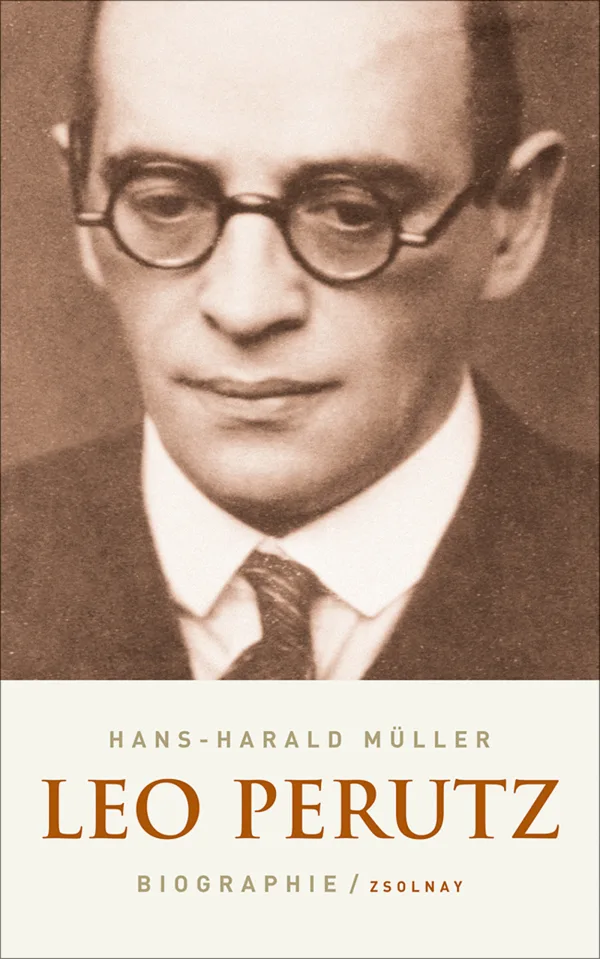Unter den wenigen Mängeln des Buchs ist einer geradezu komisch (wenn auch leicht aus anderen Quellen korrigierbar): Das genaue Geburtsdatum des Autors fehlt entweder oder steht an sehr versteckter Stelle. Man vermisst auch eine übersichtliche Auflistung der behandelten Werke von Perutz; nicht jeder hat die Bibliografie von Müller-Schirnus zur Hand … Schließlich hätten sich die Lektorinnen des Zsolnay-Verlags, dessen Loyalität gegenüber Perutz im Buch zurecht gerühmt wird (248f.), ein bisschen mehr anstrengen und ein paar Druckfehler eliminieren können.
Am schwersten wiegt, dass das Buch zwar die Einbettung von Perutz in eine bestimmte Wiener Szene umfassend und erhellend darstellt, aber das politische und ideologische Umfeld wenig berücksichtigt. Nicht dass ich zum tausendsten Mal von ‚Traum und Wirklichkeit‘ lesen möchte (in jener Ausstellung von 1985 kam Perutz übrigens noch nicht vor) – darüber weiß der Interessierte in groben Zügen Bescheid. Aber die sozialen Spannungen, der Antisemitismus, dem er auch schon vor 1938 ausgesetzt gewesen sein muss, die Klerikalisierung der Ersten Republik – das sind Aspekte, deren Vorkommen in seinem Werk (oder deren Ausblenden) hier gar nicht in den Blick kommt. Kann man den Meister des jüngsten Tages nicht etwa auch – auch! – als Abrechnung mit einer hochmütigen Offizierskaste lesen? Und manche von Müller zitierten sarkastischen Bemerkungen Perutz‘ über Juden bedürften eines Kommentars – nicht anders als die in Palästina niedergeschriebene Notiz über die (zionistischen) ‚Revisionisten‘ (302).
Die Vorzüge überwiegen aber bei weitem. So machen die so knappen wie klugen Einführungen in die einzelnen Werke (auch in manche feuilletonistische Beiträge) auf wichtige Aspekte aufmerksam, etwa auf die erkenntnistheoretischen Positionen, die oft im Hintergrund stehen und die zumeist sehr artifizielle Erzählsituation bestimmen. Dass sie mehrere mögliche Lesarten gestatten, ist fast ein Wesensmerkmal der Romane von Perutz. Müller weist auch auf bisher weniger beachtete Themen hin, etwa das der „Beschleunigung und Verlangsamung, der Dehnung und Raffung der Zeit.“ (102). Den Unterhaltungswert der Bücher schätzt er nicht gering; ihre klischeehafte Einordnung in die Literatur des Fantastischen ist ihm (zu Recht) nicht einmal eine müde Polemik wert. Zu den vielen Tugenden des Buchs gehört das Eingehen auf die Publikationsgeschichte. Wie Perutz seine Bücher vermarktet hat, wird ebenso einbezogen wie die Schwierigkeiten, mit seinem Schreiben genug Geld zu verdienen. Verhältnismäßig wenig ist über die Arbeiten für den Film zu finden; offenbar gibt es dazu kaum Material. Hier sind vielleicht in Filmarchiven noch (wenige) Neufunde zu erhoffen.
Während sich die Biografie aller Spekulationen über Einflüsse auf Perutz enthält, stellt sie die Kontakte zu Zeitgenossen eingehend dar – allein zu einer erwähnten Kontaktaufnahme mit Broch fehlt ein genauer Beleg (300) – und behandelt auch die Wirkung Perutz‘ auf Andere, so auf Brecht (besonders interessant 82ff.) Wertvoll sind viele Zitate aus Briefen und bisher nicht bekannten Veröffentlichungen (poetologisch interessant etwa der auf S. 127 zitierte Artikel von 1919, eine Kritik am Expressionismus). Müller hat mit diesem Buch weiterer Perutz-Forschung eine solide Grundlage geschaffen.