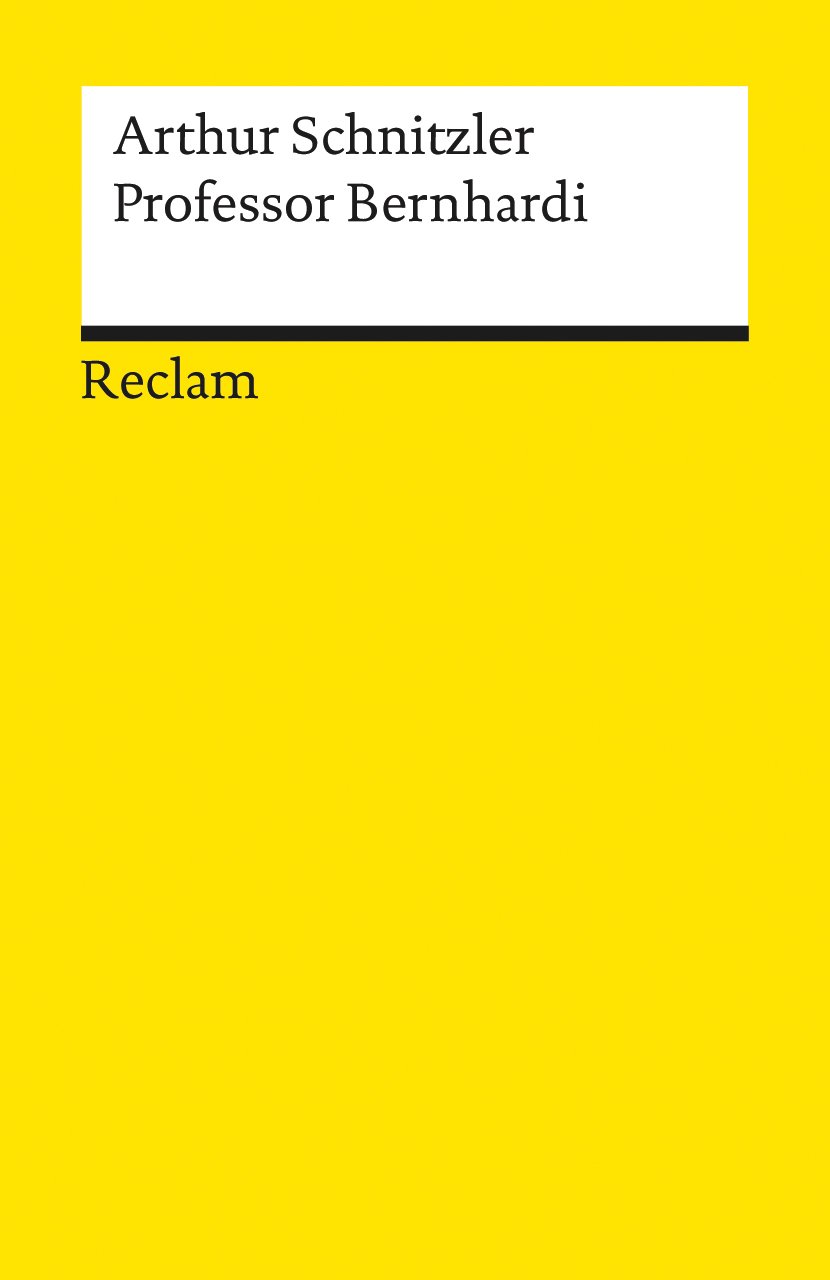Die alte sechsbändige gebundene Ausgabe im S.Fischer-Verlag ist in die Jahre gekommen und zeigt ihr Ungenügen mit aller Deutlichkeit, denn sie verweigert sich fast aller Neugierde, die der Überlieferung, den Handschriften und den Varianten gilt, und sie geizt mit Stellenkommentaren. Die rasch aufeinander folgenden Taschenbuchausgaben im Fischer-Taschenbuchverlag verhalfen zwar Schulklassen zu Leseausgaben, haben aber textkritisch eher Verschlechterungen gebracht (vgl. Konstanze Fliedls Glosse in der Editionszeitschrift „Text“, Nr. 6, Frankfurt/M., Basel 2000). So gehören heute einige der gut kommentierten gelben Reclam-Bände, die in den letzten Jahren erschienen sind (etwa „Lieutenant Gustl“, „Reigen“, „Traumnovelle“ oder „Casanovas Heimfahrt“), samt den grünen Heften mit „Erläuterungen und Dokumenten“, nicht nur zu den preiswertesten, sondern auch zu den brauchbarsten Schnitzler-Editionen, die derzeit auf dem Buchmarkt zu finden sind.
Die jüngste Neuerscheinung in der Reclam-Universalbibliothek ist die Komödie Professor Bernhardi, herausgegeben von dem Theaterwissenschaftler und Dramaturgen Reinhard Urbach, versehen mit einem gut 60seitigen Anhang, der einen kenntnisreichen Stellenkommentar, vor allem aber ein Nachwort umfaßt, das mehr liefert als eine Zusammenfassung von anderswo Gesagtem (rund fünfzig Interpretationen des Stückes sind in Urbachs Bibliographie aufgelistet).
Es lohnt sich überhaupt, heute Schnitzlers Komödie aus dem Jahr 1912 wieder zu lesen, die in den verwinkelten Krankenhausfluren und Ministerialetagen von „Wien um 1900“ verwurzelt ist, weshalb viele Interpreten sich auch ausführlich mit den zeithistorischen und biographischen Bezügen befasst haben. Von der Brisanz des Stückes kündigt schon, dass die von Schnitzler so genannte „österreichische Charakterkomödie“, die die Anlage zu einem spätbürgerlichen Trauerspiel hat, erst am Ende der österreichisch-ungarischen Monarchie, im Dezember 1918, in Wien aufgeführt werden konnte. Aber unübersehbar ist doch, dass das Stück nicht ganz und gar an die Zeit von Wien um 1900 gebunden ist. Man muß sich nicht auf den deutschen FDP-Politiker Jürgen Möllemann fixieren, der im Blick auf den TV-Talkmaster Michel Friedman erklärt hatte, am Antisemitismus seien vielleicht „die Juden“ selbst Schuld – ein Argument, das im Stück Professor Ebenwald ins Feld führt -, sondern wer den Verlauf des Intrigenspiels im fiktiven Elisabethinum studiert, das Gerangel der ehrgeizigen Konkurrenten und deren Schleichwege in die Ministerialbürokratie, wie Schnitzler das in fünf Akten detailreich entfaltet, wird ohne Mühe auf weitere Aktualitäten stoßen, denn dabei geht es keineswegs nur um den Antisemitismus der Jahrhundertwende.
Das Nachwort von Urbach setzt ein mit einer pointierten Skizze der Wiener Medizin um die Mitte des 19. Jahrhunderts (die sogenannte „zweite Wiener Schule“), die den Hintergrund des Stückes so deutlich konturiert, dass manche Bühnenanweisungen damit erst ihr Gewicht bekommen. Die Ärzte steigen aus dem Sektionskeller hoch zu ihren Patienten, und das heimliche Oberhaupt der Klinik ist der anatomische Pathologe, der „Oberkontrollor“. Von aseptischen Maßnahmen und Vorrichtungen ist nichts zu lesen in den ausführlichen Regieanweisungen, und Urbach fügt hinzu: „Privatpatienten zahlten sicherheitshalber vor der Einlieferung ins Spital“. Er erinnert an Ignaz Philipp Semmelweis, der 1849 noch als Querulant aus der Wiener Klinik für Geburtshilfe vertrieben worden war, weil er entdeckt hatte, dass die größte Gefahr für die Wöchnerinnen von den Ärzten ausging, die vom Seziersaal in die gynäkologische Abteilung kamen, und weil die Ärzte sich anzuerkennen weigerten, dass sie selbst jene Krankheit verursachten, die sie heilen wollten. So versteht man die hinterlistige Frage des jungen Mediziners im Stück, was als „Ursache der Sepsis“ im Protokoll vermerkt werden soll. Die Ärzte verstanden sich als Wissenschaftler; Heilungserfolge nahmen sie gerne in Kauf, vor allem aber ging es ihnen um das Verstehen, das Beschreiben, das Diagnostizieren. Ein therapeutischer Erfolg gilt als Zufall, solange er nicht wissenschaftlich begründet ist. Das spiegelt sich im simplen Faktum, dass im ganzen Stück kein einziger Patient geheilt entlassen wird.
Professor Bernhardi, der Chef des Elisabethinums, ist von Schnitzler also nicht als Lichtfigur angelegt, auch nicht in jener Szene, in der er vor dem Krankenzimmer der Sterbenden eine ideologische Debatte führt, ob man Kranke über ihren moribunden Zustand täuschen darf. Man kann es Lüge nennen, wie sein integrer Kollege Kurt Pflugfelder es tut, der einzige, welcher der Sterbenden schließlich Trost spendet, während die anderen Beteiligten draußen ihren großen Disput führen. Denn Bernhardi kann sich keineswegs sicher sein, ob die Patientin die letzte Ölung nicht doch als Segnung empfunden hätte. Schnitzler läßt ihn auf sein Recht pochen, durch Täuschung zu trösten. Und Bernhardi durchschaut auch nicht das Intrigenspiel, das über diesen Disput ausbricht: So sieht er in dem Hofrat Winkler einen Gleichgesinnten, glaubt den scheinbar wohlmeinenden Worten eines Bischofs und fühlt sich beruhigt durch die Schmeicheleien des Kronprinzen, der ihm Kumpanei vorschwindelt. Er vertraut darauf, dass das Elisabethinum die Kraft besitzt, Nationalismus und Antisemitismus zu ethischem Liberalismus zu amalgamieren, doch Schnitzlers Psychogramm des Kandidaten der Medizin Horchroitzpointner zeigt vor allem, dass der Antisemitismus gesellschaftsfähig geworden ist und damit das probate Mittel, mit dem sich der Konkurrenzkampf gegen Bernhardi führen läßt. Zwar scheint am Ende Bernhardi recht zu behalten, aber der fragile Schluss der Komödie, in der der Antisemitismus kraft der überzeugenden Vernunft sich für einen Augenblick in Nichts aufzulösen vermag, erinnert auch daran, dass Schnitzler im Jahr 1912 die Handlung zurück in die Jahrhundertwende gerückt hat.