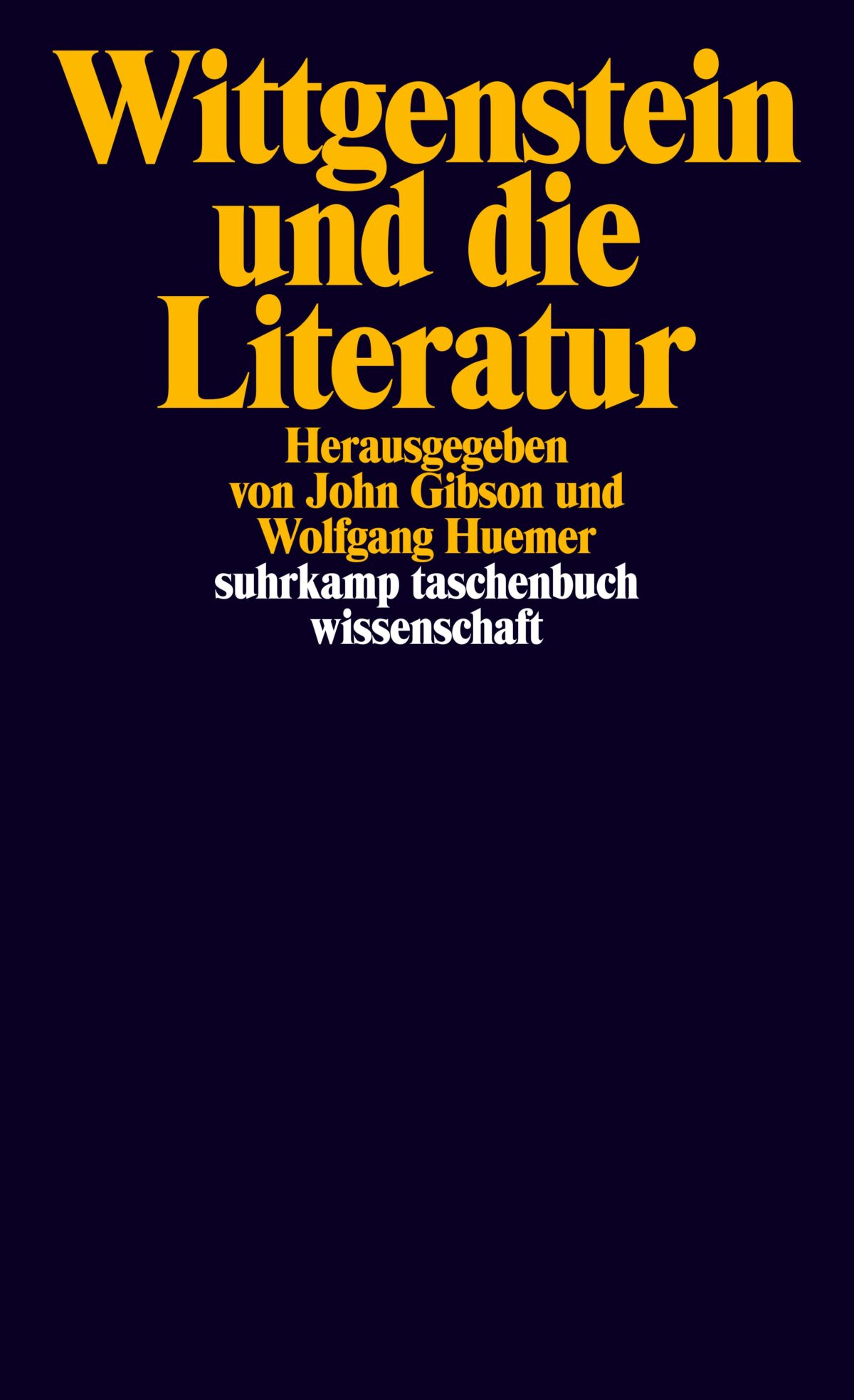Das ist redlich und Folge des eher dem Zweifel als der Antwort verpflichteten Vorgehens dieses Bandes: Die Brüche in Wittgensteins Denken und Schreiben werden nicht verschwiegen, die Beiträge dürfen in Ansatz und Aussage so verschieden sein wie die Themen (u.a. „Wittgensteins Untersuchungen und Hölderlins Poetologie“, „Lesen aus Interesse am Leben“ oder „Wittgenstein, ‚Herz der Finsternis‘ und Sprachskeptizismus“) und keiner fordert, bei der Auseinandersetzung mit diesem inkohärenten Werk definitive Lösungen bereit zu halten. Was also die Herausgeber zu Recht verweigern – unangefochtene Grundlagen aufzuweisen, Konsens zu beschwören -, sollte die Rezensentin nicht erledigen. Beherzt wird deshalb auf eine Zusammenfassung der einzelnen Artikel verzichtet (wer will, kann einen schematischen Abriss der einzelnen, vor allem aus dem englischsprachigen Raum kommenden Beiträge auf den Seiten 22-29 nachlesen) und dafür der Leser auf den entschleunigten und langen Weg des kritischen sapere aude geschickt. Wittgensteins Philosophie, das zeigt der über 500 Seiten dicke Band einmal mehr, ist nicht auf wenigen Seiten zu verhandeln, es sei denn um den Preis von Gemeinplätzen. Ein Hinweis auf die thematischen Schwerpunkte möge deshalb genügen – I. „Philosophie als Literatur/Literatur als Philosophie“, II. „Lesen mit Wittgenstein“, III. „Literatur und die Grenzen von Selbst und Sinn“, VI. „Fiktion und der Tractatus„, sowie V. „Eine weitere Perspektive“, – und eine Skizze der Einleitung, die folgt.
Das Thema Wittgenstein und die Literatur mag, geht man nicht von der impliziten, sehr bewusst gewählten literarischen, ja kunstvollen Form dieses Schreibens aus, das sich stets souverän über die stilistischen Konventionen für philosophische Texte hinwegsetzte, zunächst – so jedenfalls Wolfgang Huemer – merkwürdig klingen. Zum einen, weil sich Wittgenstein nie explizit dieser möglichen Verbindung zuwandte, zum anderen weil die positivistische Sprachphilosophie – zu der sich auch der Tractatus bekannte – die poetische Rede ablehnte; waren ihre Vertreter doch daran interessiert, ob und wie die Wörter die Welt möglichst eindeutig abbilden könnten. Dazu analysierten sie die Sprache als abstraktes System, deren auf Aussagesätze reduzierte logische Form es zu (re-)konstruieren galt. Bertrand Russell damals so apodiktisch wie aus heutiger Sicht befremdlich: „Die Propositionen in dem Stück [Hamlet] sind falsch, da es nie einen solchen Mann gegeben hat“. Dass sich mit solchen Kahlschlägen die Probleme nicht beseitigen lassen, zeigen die Beiträge von Burri und Jacquette im IV. Kapitel zu Wittgensteins Tractatus und seiner Logik der Fiktion.
In der Tat war für Wittgenstein spätestens mit den Philosophischen Untersuchungen die Abbildtheorie hinfällig: Von nun an begriff er Sprache als Praxis, deren vielfältigste Funktionen es zu untersuchen galt. Damit kam auch die Dichtung wieder zu ihrem Recht. Sie musste nicht länger ihren besonderen ontologischen Status verleugnen („Ein Bild kann Beziehungen darstellen, die es nicht gibt!!! Wie ist das möglich?“, heißt es noch im Tagebuch vom 30.9.1914). Im Gegenteil: Gerade weil Dichtung „gewisse Arten von Wahrmachern“ (Alex Burri) besitzt und darüber hinaus die Harmonie von Stil und Inhalt vor Augen führt, das heißt, mit ihren Metaphern den Reichtum sprachlicher Möglichkeiten und sprachlichen Tuns erst eigentlich demonstriert, war sie geeignet, mit dem erkenntniskritischen Anliegen der Philosophie zu koinzidieren. Auf der anderen Seite war die Literatur – als sekundär modellierendes System – nie abgetrennt von der Alltagssprache, übernahm also eine wichtige Brückenposition zwischen Episteme und ‚Welt‘. Nicht länger reduziert auf Referenz und logische Form, konnte der neue, funktionalistische Ansatz aber auch als Korrektur der späteren poststrukturalistischen Positionen aktiv werden, die allzu rigoros den Tod des Autors verkündeten.
Im Gegensatz zu diesen machen uns Wittgensteins Überlegungen klar: Strukturiertheit von Form und Ausdruck sind gar nicht anders zu denken als unter dem Kennzeichen der Intentionalität, das heißt, eines Subjekts, das diese Struktur nicht vorfindet und beschreibt, sondern allererst erzeugt. Dies impliziert im übrigen, Intentionalität in zweifacher Weise zu verstehen: 1. als Telos, ohne den Handlungen, auch Sprachhandlungen, überhaupt nicht sinnvoll beschrieben werden können, und 2. als Botschaft/Mitteilung, für die auch Wittgenstein – nicht anders als die Poststrukturalisten – die Dichtung selbst nie einspannen wollte (man denke an seine gegenüber Ludwig von Ficker kurz vor Trakls Tod in Bezug auf dessen Gedichte gemachte Äußerung: „Ich verstehe sie nicht; aber ihr Ton beglückt mich“). Trotzdem gelingt es der Literatur – so jedenfalls zahlreiche Interpreten von Wittgensteins Denken -, ganz besonders intensiv von Intention, Norm, Wert, Konvention und Ethos zu sprechen, und sie kann dies anscheinend, weil sie metatextuell auf die Regeln des sprachlichen und sozialen Handelns verweist, in ihr Sprache und Sprechen selbst zum Thema werden. Eine Erkenntnis, für die man nicht erst auf die geläufigen dichterischen Genres Prosa, Lyrik, Drama zurückgreifen muss; eigentlich spricht Sprache immer auch von sich selbst, nur, dass das ‚Durchscheinen‘ der Regel in der Poesie in ganz besonders radikaler und auffälliger Weise vollzogen wird.
Klar sollte damit auch sein: Ohne Einbeziehung des Lesers geht es nicht. Er spielt in diesem kommunikativ-funktionalen Modell, dem es nicht mehr um Erklärungen, sondern um eine möglichst detaillierte Beschreibung unseres Sprachgebrauchs geht, neben dem Autor die zweite, entscheidende Rolle (weshalb auch ein Artikel wie der von Marjorie Perloff zur Frage der Übersetzbarkeit von Dichtung wunderbar in diesen Band passt). Wir, die Rezipienten, sind aber auch dafür verantwortlich, dass Sprechen, Reden, Denken, Verstehen sich als so kreativ und eindeutigkeits-resistent erweisen. Sprache ist eben ein situatives Spiel mit vielen Parteien und Facetten; das Sprachspiel des Philosophierens und des Dichtens eingeschlossen. Grund, warum sie so lebendig und funktionstüchtig bleibt und es schafft, Individuelles und Allgemeines, Gegenwart und Vergangenheit, Moderne und Tradition, zu verbinden. Grund auch, warum Wittgenstein-Exegesen wie die in diesem Band versammelten, trotz des „Hinundherschwankens“ und der oft ergebnislosen Anstrengungen, die sie bei ihren Interpreten auslösen, doch unzweifelhaft Lust bereiten; Lust, den Verstand zu schärfen, so dass wir am Ende mit Joseph Margolis – trotz der von ihm prophezeiten „Unwahrscheinlichen Aussichten für die Anwendung von Wittgensteins ‚Methode‘ auf die Ästhetik und die Philosophie der Kunst“ – sagen dürfen: Wittgenstein ist diese Mühe wert.